Offene Welten liegen im Trend. Das haben Max und ich schon ein paar mal festgestellt, zuletzt in unserem (ersten) Rückblick auf 2015. Auch Rollenspiele gewähren vor allem in letzter Zeit ihren Spieler*innen viel Freiheit, denken wir beispielsweise an Dragon Age: Inquisition, The Witcher 3: The Wild Hunt und natürlich Fallout 4. Letzteres wurde zwar für seine Welt und die spielerische Vielfalt gelobt, allerdings auch für seine oberflächliche Story kritisiert. Und an Dragon Age: Inquisition wurde ebenfalls bemängelt, dass es zwar schön sei, so große Areale zu haben, ohne Inhalt wären diese aber letztlich kaum sinnvoll. Mich persönlich stört aber vor allem ein Aspekt, bei Open-World-Rollenspielen: Das Auto-Leveling.
Auto-Leveling und Open World ergänzen sich im Prinzip recht gut. Denn wenn die Entwickler*innen nicht kontrollieren können, wo der Spieler*innencharakter hingeht, um die offene Welt zu erkunden, muss wenigstens sicher gestellt sein, dass die Spieler*innen stets herausgefordert, aber nicht überfordert werden. Oft fehlt in einer Open World das für Rollenspiele übliche Railroading am Anfang, um sicher zu gehen, dass das Spielprinzip verstanden und die Story ans Laufen gebracht wurden. Deshalb begegnen einem bei Skyrim auch anfangs sehr viele Wölfe und niedrigstufige Banditen, seltener Drachen und Trolle. Und in Fallout 3 schlugen sich die Spielenden dereinst mit mutierten Skorpionen und Ameisen herum, bevor sie gegen Raider und Todeskrallen antreten durften. Nur: so richtig mächtig fühlen sich die meisten Spieler*innen nicht wirklich.
Via Flickr, by Pikawil
Denn selten sind die Charaktere in wirklicher Gefahr, da genau das Auto-Leveling dafür sorgt, dass die Gegner zwar schwierig, aber nicht gefährlich, der Einsatz der Spieler*innen groß, aber nicht zu groß ist (eine Lektion, die Bethesda erst nach Oblivion gelernt hat). Dadurch bekommt man hinter der Tastatur oder dem Controller nie das Gefühl, mit Glück und Verstand einen Gegner besiegt zu haben, sondern stehts nur deshalb, weil man ihn eben besiegen sollte. Bestes Beispiel dafür sind die Drachenkämpfe in Skyrim: Bereits früh im Spiel darf der Charakter einen Drachen besiegen, später schwingt sich ein solcher regelmäßig vor die Füße des*der Dovahkiin, obwohl sie oder er gerade wirklich etwas Besseres zu tun hatte (und auch nicht genug Platz im Inventar für diese scheißschweren Drachenknochen). Alle Nase lang tötet der Charakter also Drachen, weil diese eben genau ihrem oder seinem Level entsprechen – und nie stellt sich das Gefühl ein, gerade das mächtige und mythische Wesen erschlagen zu haben, welches uns das Spiel vorgaukeln will. Epik geht anders.
Wie offene Welten und Rollenspiele trotzdem funktionieren können, zeigen die Gothic-Spiele, später auch Risen. Denn dort startet der Held immer schwach und stirbt schnell, sollte er sich abseits der Pfade über die Welten trauen. Der Tod durch Übermut ist am Anfang einkalkuliert und gibt den Spielenden das Gefühl, nicht nur in einer nachvollziehbaren Welt zu existieren, sondern später, nachdem sie es geschafft haben, die einstmals gefährlichen Gegner zu besiegen, auch wirklich Fortschritte gemacht zu haben. Ein ähnliches Phänomen bietet ja auch Dark Souls: Der eigene Charakter ist ziemlich verletztlich, aber gerade dadurch gewinnt der Sieg über Endgegner den besonderen Geschmack des Triumphes. Der Machtzuwachs durch Autoleveln wird lediglich durch ein paar Zahlen und vielleicht neue Gegner beschrieben, in eher lineareren Rollenspielen wie Gothic aber wird mir mein Vorankommen auch durch die Welt gezeigt.
Via Flickr, by Cathrine
Ähnlich macht es das vor kurzem für den PC erschienene Dragon’s Dogma. Zwar können Spieler*innen relativ frei die Welt erkunden – zumindest nach den ersten paar Stunden – aber das heißt nicht, dass sie dort mit offenen Armen empfangen werden. Das Spiel macht einem an jeder Ecke klar: Dort draußen ist es gefährlich, vor allem Nachts, und es ist nicht schlimm, wegzulaufen. Dafür ist das eigene Triumphgefühl umso größer, wenn der Zyklop mit ein bisschen Teamwork und strategischem Erklettern bezwungen oder die Chimäre mit Einsatz von Stahl und Magie gefällt wurde. Der Reiz liegt im schrittweisen Erkunden der Welt, dem Austesten der Grenzen, ja, auch dem Verlieren, weil der Gegner zu stark war. Die Freude ist dann nur umso größer, wenn der Charakter später mit mehr Fähigkeiten und besserer Ausrüstung zurückschlagen kann.
Die Krux bei modernen Open-World-Spielen ist die Tendenz, die Spieler*innen zu sehr an die Hand zu nehmen, damit sie durch Rückschläge bloß keinen Spaß am Spiel verlieren. Das zeugt leider von wenig Mut der Entwickler*innen, die ihrem Publikum zu wenig zutrauen. Aber gerade der Erfolg von Dark Souls und seinen Nachfolgern, sowie bockschwerer Plattformer wie Super Meat Boy zeigen, dass sich viele Spieler*innen eine Herausforderung wünschen. Also, warum nicht ein bisschen weniger Händchenhalten, und dafür mehr “richtige” Freiheit in einer nachvollziehbaren Welt?
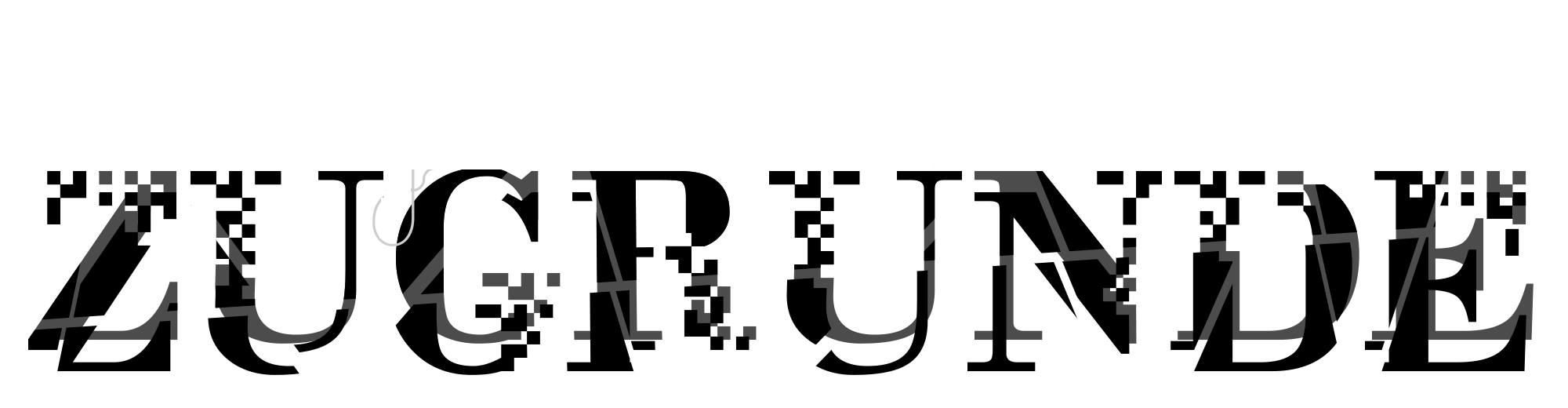






Leave a Reply