„American Sniper“, also. Ein Film voller bitterem Nachgeschmack. Ein Film voller vergebener Möglichkeiten. Clint Eastwood beweist der Filmemacherwelt, dass er derzeit keine Muse hat und Amerika beweist sich selbst, dass es Probleme hat. Nur leider werden diese Probleme nicht angegangen. Die Probleme werden mit falschen Lösungen bedacht und ein Ende des Kriegs gegen den Terror ist nicht in Aussicht. „American Sniper“ wurde nicht aufgrund seiner Qualitäten als Film ausgezeichnet. Der Film wurde auch nicht für Bradley Coopers Schauspiel gewürdigt. „American Sniper“ ist für den Soldaten Chris Kyle nominiert worden. Wer etwas Anderes behauptet, der hat die Oscars und die amerikanische Politik der letzten Jahre völlig außen vor gelassen.
Seit 2010 und dem „Hype“ um Hurt Locker und seiner vermeintlich realistischen Darstellung dreht sich wieder Vieles um „wahre Geschichten“. Es wird darüber hinweg gesehen, dass Filme wie „12 Years A Slave“ ordentliche Probleme als Film in Sachen Erzählung haben, wenn denn nur das Prädikat „Wahrheit“ dahintersteht. Dass sich beides mit dem richtigen Material und einer guten Regie sowie einem starken Screenplay hinbiegen lässt, hat „Argo“ gezeigt. Der Film setzt auf viele Elemente, die für die damaligen Ereignisse nicht vorrangig waren und schraubt hier und da an der Chronologie der Ereignisse. Damit steigt jedoch auch die Spannung und der Film muss nicht noch ein paar „wahre“, doch für den Zuschauer nur wenig interessanten Begebenheiten abgrasen.
Das beste Beispiel für solche Kritik war in den letzten Jahren Bigelows zweiter (Kriegs-)Wurf „Zero Dark Thirty“. Ein Film bestehend aus einzelnen Ereignissen, die kläglich durch eine dröge Rahmenhandlung noch unzusammenhängender wirkten. Aus diesen Fehlern konnte Eastwood für seinen „American Sniper“ zwar lernen, doch die „Wahrheit“, die uns der Film auftischt, ist nicht minder langweilig geraten.
Meanwhile in Soviet Metro Legoland…
Ein guter Soldat macht noch keinen guten Menschen
Für ein militärisches Dasein war Chris Kyle sehr wahrscheinlich ein Held. Das möchte ich gar nicht einschränken. Er war allem Anschein nach ein guter Soldat und Kamerad mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Die Geschichte einer solchen Person haben wir allerdings schon zu oft als Film gesehen. Kyle durchlebt genau die Stadien, welche die großen Kriegsfilme wie „Platoon“, „Apocalypse Now“ und „Full Metal Jacket“ uns immer wieder aufzeigen.
Die Unfähigkeit in das normale Leben in der Heimat zurückzukehren ist dabei das Thema, welches die Schwäche des Films offenbart. Wir folgen dem „Cowboy“ und Texaner Chris Kyle wie er sich für sein „großartiges“ Land entscheidet und es verteidigen möchte. Bis zum Ende sind die Feinde „Wilde“ und Kyle glaubt an das Gute und Richtige seiner Taten. Wenn er von seinen Touren heimkommt, hat er typische PTSD-Erscheinungen, die er sich aber nicht eingestehen möchte.
Was folgt sind weitere Touren. Weitere Verluste, weitere Gefechte, die für den Zuschauer wie für die Soldaten kaum zu greifen sind. Warum gekämpft wird, ist schnell gar nicht klar. Was eine weitere Straßenschlacht in diesem Krieg ausmacht, lässt sich nicht in Relation setzen. Diese Fragen wirft der Film jedoch nicht auf. Er bezieht sich nicht auf die Sinnlosigkeit des Krieges, sondern entführt uns in das Biotop dieser Soldaten, die keinen anderen Alltag kennen. Leiden tun nur die Überlebenden.
Mit der mangelhaften Wiedereingliederung beschäftigt sich der Film nicht. Obwohl wir jedes Heimkehren gezeigt bekommen und Kyles nervöse Reaktionen sehen, befasst sich der Film kaum mit seiner am Ende scheinbar gelungenen Wiedereingliederung. Stattdessen wird ein „Duell“ mit einem relativ gesichtslosen Feind aufgebaut, welches in einer furchtbar gelösten Slo-Mo-Szene aufgelöst wird. Das anschließende Feuergefecht inmitten eines Sandsturms sorgt dann tatsächlich mal für Herzklopfen und wenn es nur der Abwechslung gedankt werden kann.
Neben der Kameraeinstellung eines zurückgelassenen Gewehres schafft der Film es nie über Bilder zu funktionieren. Wenn der Film auch nur ansatzweise interessant sein soll, muss Cooper sein Repertoire an Emotionen abrufen. Doch ganz ehrlich reichen diese Shots nicht, da Kyle kein sonderlich interessanter Mensch war. Er war schlichtweg ein guter Soldat, der mit den gleichen Problemen wie alle Veteranen zu kämpfen hat. Und genau dieser Kampf wird in Eastwoods Heldenportrait außen vor gelassen.
Ein Film will keine Schwäche zeigen
Die emotionalste Szene des Films ist ein Barbecue, welches darin Endet, dass Kyle einen Hund mit seinem Gürtel verprügeln will. Er ist zu einem schreckhaften und mit Gewalt antwortendem Wesen geworden, das seinem zu Beginn gezeigten Vater zu gleichen droht. Ein stumpfer, aber „treuer“ Christ, der meint die Exekutive des Guten sein zu müssen. Ob das Gute tatsächlich gut ist, bleibt jedoch Kyle selbst überlassen.
Diese Szene kommt jedoch erst nach knapp zwei Stunden. Der Krieg und der Film sind vorbei. Der innere Krieg des Chris Kyle wird mit einer kurzen Szene bei Veteranen abgehakt. Anstatt einer glaubwürdigen Entwicklung wird dem Zuschauer eine Wunderheilung verkauft. Kyle findet seine Berufung darin Veteranen zu unterstützen, doch anstatt diese Vorgänge zu zeigen, haben wir circa 100 Minuten einen unsagbar durchschnittlichen und wenig interessanten Kriegsfilm gesehen. Wie zum Beispiel bei „12 Years A Slave“ wird man entgegnen, dass es doch aber wirklich so passiert sei. Dazu entgegne ich, dass man dann vielleicht besser eine Dokumentation statt einer Stilisierung hätte machen sollen.
Chris Kyle hätte nach seinem Tod als Zeichen genutzt werden können. Seine Zuwendung an die Veteranen und die Konfrontation mit seinen eigenen Problemen, die er scheinbar erfolgreich bekämpfen konnte, sind die verlorenen Chancen dieses Films. Amerika hat ein großes Problem mit Veteranen. Es ist eine vom Krieg gebeutelte Nation, die alle 20 Jahre in einem augewachsenen Krieg zu landen scheint. Die Verlierer sind oftmals auch die Überlebenden, die kein Geld und, wichtiger noch, keine Bindung zur Gesellschaft finden. Wo ist die Arbeit, die Kyle für diese Menschen geleistet hat?
Via Flickr by UK Ministry of Defence
Why so serious? Auch hinter Soldaten verbergen sich Menschen…
Warum wird diese viel zu selten erzählte Geschichte für dutzende Schießereien hergegeben? Viele Amerikaner rührt es noch heute zu bitteren Tränen, wenn sie mit den Bildern des 11.Septembers konfrontiert werden. Doch wem hilft es, wenn wir einen Toten allein für seine Taten in Übersee honorieren? Der im Film gepriesene Chris Kyle wird für seine „herausragenden“ Dienste im Krieg geehrt. Das Jahr 2015 braucht nicht mehr einen „James Ryan“ und auch kein “Platoon”. Es hätte ein Jahr über den heimischen (amerikanischen) Kampf mit den Folgen dieser Kriege werden können. Ähnlich kritisch wie bei „12 Years A Slave“, wird das spätere soziale Engagement des Protagonisten lediglich als Text erwähnt.
So droht der Veteran und Mensch Chris Kyle zu einem weiteren Soldaten zu werden, der Mahnmal und Ansporn zugleich sein soll. Krieg ist schlecht, aber wehe ihr legt euch mit den Amerikanern an. Weiß Eastwood selbst noch, was er mit einem solchen Film erzählen will? Oder versteckt er sich am Ende auch hinter der Aussage, dass doch nur das (Kriegs-)Leben eines tapferen Mannes verfilmt werden sollte? Das wäre wirklich feige und ist schlichtweg etwas, das ich der Herangehensweise dieses Filmes vorwerfen muss.
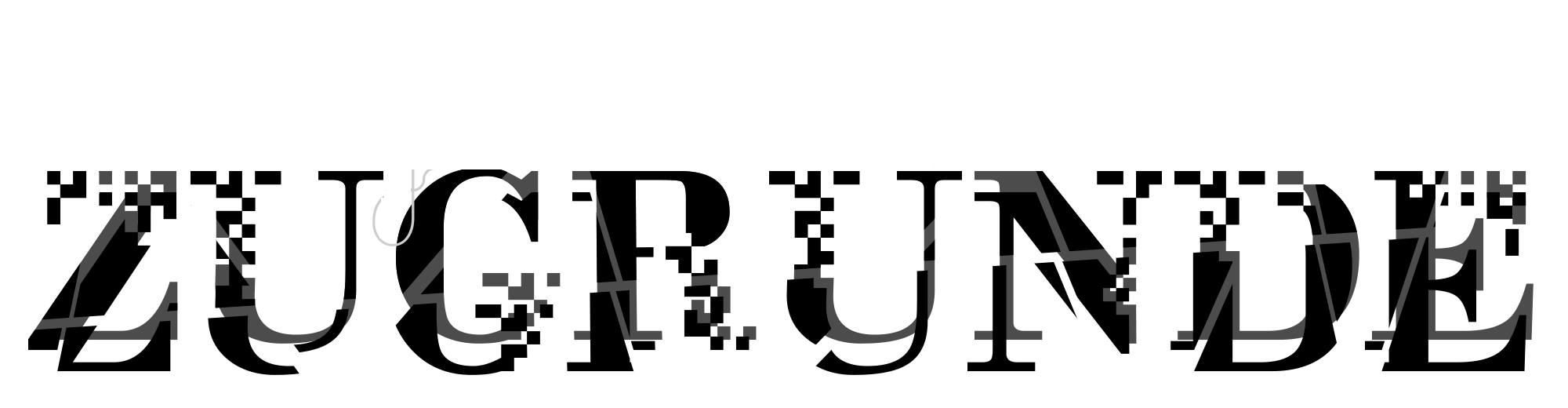






1 Pingback