Laut boxofficemojo.com hat der neueste Mad-Max-Film weltweit über 300 Millionen Dollar eingespielt. Damit ist er ein ziemlicher Erfolg, selbst wenn mensch das 150-Millionen-Dollar-Budget abzieht. Abgesehen davon, dass der Film auch einfach ziemlich gut ist, stellt sich nun die Frage: Gibt es mehr davon? Klar, Mad Max bekommt (noch) einen Nachfolger, das steht fest, aber werden nun vielleicht mehr Endzeit-Filme freigegeben? Wird die erfolgreiche Videospielreihe Fallout (deren vierter Teil vor kurzem angekündigt wurde) eventuell ihren Weg auf die Leinwand finden? Alles Fragen, die interessant, aber nicht sehr aufschlussreich sind. Viel wichtiger ist doch: Warum finden wir die Postapokalypse so verdammt spannend?
Zunächst aber kurz zur Klärung: postapokalyptische Szenarien sind fast immer Dystopien, aber nicht immer sind Dystopien auch postapokalytpisch. Die bekannteste Dystopie, 1984 von George Orwell, ist beispielsweise eine Dystopie, von Endzeit merkt mensch allerdings recht wenig. Und auch der erste Teil der Mad-Max-Reihe spielt nicht in einem Endzeit-Szenario, sondern trägt eher dystopische Züge. Interessanterweise ist der Zusammenbruch der menschlichen Zivilisationen bereits ein recht altes Thema, vielleicht sogar älter als die Dystopie.
Denn die Endzeit als Setting ist kein neues Phänomen. Seinen ersten Höhepunkt hatte es in den 1960er und 1970er-Jahren, als Nachwehe und -Wirkung des “Golden Age” der Science-Fiction – damals, als es nur manchmal um Laser, Raumschiffe und Explosionen ging. Von der Literatur gelangte der Stoff dann in den 1970ern und vor allem 1980ern vermehrt auf die Kinoleinwände. Eine zweite Hochphase lässt sich auf die späten 2000er datieren, als das Untergenre der Zombie-Apokalypse (wieder) populär wurde. Die erste Endzeit-Geschichte, von der wir wissen, gab es allerdings bereits 1805, später setzten sich dann Mary Shelley und Edgar Allan Poe in ein paar Texten mit den Nachwirkungen eines Kataklysmus auseinander. Beides übrigens Schriftsteller der frühen, “Gothic” genannten Horrorliteratur.
Furcht und Schrecken
In der Vorstellung der Endzeit-Welt als Horror findet sich auch eine erste Erklärung für die Faszination der Postapokalypse. Deren Bild ist meist geprägt vom einsamen Wanderer (weibliche Perspektiven sind leider selten), der sich alleine durch die Reste der Zivilisation schlägt. Sein Feind dabei ist oft nicht nur die Natur, sondern vor allem der Mensch, der dem Protagonisten oft die Funde und Errungenschaften streitig macht. Die Idee vom vereinzelten Menschen steht aber entgegengesetzt zur menschlichen Erlebniswelt noch bis in die 1970er Jahre hinein, die geprägt war vom Zusammenleben. Das Leben mit anderen Menschen, Verwandten, Arbeitskollegen, Freunden usw. war grundlegend für die Allermeisten, besonders in der Welt vor dem Wirtschaftsboom der 1950er Jahre. Demnach war die Vorstellung eines/einer einzelnen Überlebenden, der/die als “letzter Mensch” die Erde bewandert, eine tatsächliche Horrorvorstellung. Sie konfrontiert den Menschen der Massengesellschaft mit einem völligen Verlust seines Bezugssystems. Die Einsamkeit ist dabei das eigentliche Grauen, die Abwesenheit eines Gegenüber, über welchen sich Menschen definieren können. Zum Fürchten ist auch der Gedanke, trotz der Weite des Ödlandes schließlich mit sich selbst eingesperrt zu sein.
Die postapokalyptischen Geschichten der 1950er bis 1970er Jahre waren dann oft Verarbeitungen der möglichen Tatsache einer atomaren Auslöschung. Die Autor*innen der damaligen Zeit steckten in einem besonderen Zwiespalt: Zum einen wurde ihnen von allen Seiten eine rundum glückliche Konsumwelt präsentiert, in der sich Leistung wieder lohnt und Wohlstand für alle möglich ist, zum anderen war die Bedrohung durch den Kalten Krieg derart zum Greifen nahe, dass zum Beispiel in den USA Kinder für den Fall eines Nuklearangriffs gedrillt wurden. Es herrschte also allgegenwärtige Gefahr, dass der ganze Wohlstand mit dem Druck eines Knopfes wortwörtlich verpuffte, und zwar im Explosionsradius einer Atombombe irgendwo zwischen 300.000 und 3.000 Grad Celsius. Angesichts der Ungeheuerlichkeit eines nuklearen Schlagabtauschs und den leider zu gut bekannten Auswirkungen der Bomben von Hiroshima und Nagasaki, handeln auch viele Endzeitgeschichten dieser Phase von den möglichen Lehren und Gegenentwürfen einer neuen, vielfach “primitiv” dargestellten Gesellschaft. Die postapokalyptischen Storys der damaligen Zeit waren Unterhaltung und Therapie einer ganzen Generation.
Gleichzeitig findet sich auch die Verarbeitung einer weiteren, zeitgenössischen Erfahrung, die Hannah Arendt als “atomisierte Gesellschaft” bezeichnete. Grob gemeint ist damit die gefühlte Entwertung des Individuums, angesichts von Massenarbeit in Fabriken und Großraumbüros. Der Mensch nimmt sich selbst nur als Rädchen im (wirtschaftlichen) Getriebe der Gesellschaft wahr und fühlt sich seiner Fähigkeit beraubt, etwas Bleibendes in dieser Welt zu schaffen. Demgegenüber steht dann die Held*innenfigur in Science-Fiction-Geschichten, deren/dessen ohnehin herausragende Stellung im Endzeit-Genre als vielleicht “letze*r Überlebende*r” der Menschheit nochmal verstärkt wird. So erträumt sich das kleine Zahnrad eine Rolle als Steuerknüppel.
Das Verhältnis Individuum gegen Menschenmassen findet dann in der Zombie-Apokalypse ihren Höhepunkt. Fast schon misanthropisch versuchen hier die Überlebenden teilweise ihre früheren, nun zomibifizierten Freunde und Verwandte zum endgültigen Ableben zu bewegen, um ihre eigene Haut zu retten. Die gesichtslose Menschenmasse in Großstadtplätzen, Berufsverkehr-U-Bahnen und Musikgroßveranstaltungen mutiert zu einem blutrünstigen Korpus aus Leibern, die nur eines im Sinn haben: Ihren Hunger zu stillen mit dem Fleisch der wenigen Individuen, die sich noch nicht der Massengesellschaft verschrieben haben. Hätte es die Idee der Zombie-Apokalypse bereits in den 1920ern gegeben, sie wäre eine perfekte Parabel auf den Faschismus gewesen!
Endlich entkompliziert in der Endzeit
Besonders in der heutigen Zeit bietet ein Endzeitszenario vor allem einen großen Reiz: Es ist so herrlich unkompliziert. Unsere heutige Welt wird von vielen Menschen als fast überkomplex erlebt, als Welt, deren Probleme so hoffnungslos miteinander verzahnt sind, dass sie kaum noch auseinanderzuklamüsern sind. Deswegen haben vermeintlich “einfache” Verschwörungstheorien so einen Aufschwung in den letzten Jahren erlebt, da sie die Ursache fast aller Probleme meist auf eine bestimmte Gruppe oder Institution schieben können (sei es die USA im Allgemeinen oder deren Federal Reserve Bank im Besonderen, die NATO, die EU, Putin, China, ChemTrails, Bilderberger, Illuminaten, Majestic Twelve, Juden, Muslime, Terroristen, Plutonium, Hitler im Weltraum oder dann eben doch diese Reptilienmenschen im Inneren der Erde). Durch die Apokalypse wurden all diese Interessengruppen hinweggefegt, was bleibt ist ein gemeinsames Ziel aller Menschen: Überleben. Dazu müssen die Endzeit-Menschen sich keine Gedanken mehr über Gleichberechtigung, politische Korrektheit, Migration, Terrorismus oder die verdammten Reptilienmenschen machen, sondern einzig und allein: Überleben. Ganz einfach.
Die Postapokalypse ist in ihrem Schrecken somit auch Erlösung vom erdrückend und komplex empfundenen Alltag. Die Auseinandersetzung mit den Mitmenschen erfolgt nach klaren Regeln der Nützlichkeit, nicht nach Fragen des gesellschaftlichen Standes. Das Fehlen eines Rechtssystems erlegt es dem Einzelnen auf, nach Recht und Unrecht zu urteilen, es gelten nur die eigenen Regeln. Der Mensch der Endzeit ist im absoluten Sinne frei. Zugleich ist damit aber auch die Situation aus Thomas Hobbes’ Naturzustand – Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf (Homo homini lupus est) – fast idealtypisch wiedergegeben. Denn der oder dem Anderen wird in der Postapokalypse (besonders jenen mit einem Kriegs- oder Pandemie-Hintergrund) zunächst mit Misstrauen begegnet, nicht mit Freude darüber, dass noch jemand überlebt hat. Oft genug erleben die eigenbrötlerischen Held*innen dieses Genres aber eine Wandlung hin zu einem vertrauensvolleren Umgang. Auch am Ende der Menschheitsgeschichte bleibt dessen Bild also zwiespältig.
Via Flickr, by Bill Devlin
 So schön und zugleich gefährlich wie eine Sandwüste
So schön und zugleich gefährlich wie eine Sandwüste
Natürlich ist die Faszination für die Postapokalypse vielschichtig. Interessanterweise wird durch die letzte Interpretation der Endzeit als Komplexitätsreduktion das ursprüngliche Bild als Horrovorstellung ins Gegenteil verkehrt. Trotzdem ist die Schreckensvorstellung der Auslöschung weiter Teile der Menschheit und die damit einhergehende Einsamkeit der Menschen schließlich wohl dominierend. Denn der Gedanke, ganz alleine zu sein, ist wirklicher Horror. Diese Einsamkeit beraubt den Menschen der grundlegenden Möglichkeit, sich seiner eigenen Existenz mit und durch andere zu vergewissern. Damit wir nicht denken, dass sich unser Leben nur in unserem eigenen Kopf abspielt, brauchen wir weitere Menschen. Egal, ob wir Menschenmassen bedrohlich finden, oder den Umgang mit Anderen als lästig empfinden, weil wir plötzlich auf deren Kultur Rücksicht nehmen sollen: Wir alle sind soziale Tiere und brauchen einander. Das können alle Bomben, alle Pandemien und Zombies auf der Welt nicht ändern.
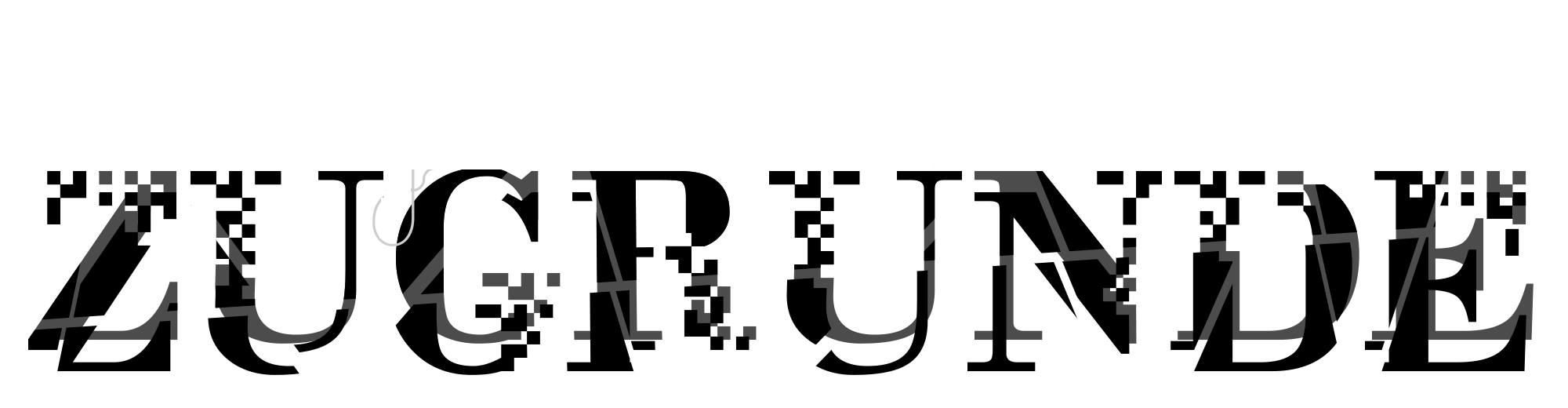




Leave a Reply