Ach Whiplash, du hättest so viel sein können. Die Schnitte, die Kamera, das Licht – ein Traum, ein wahrer Traum, der einem*r da entgegen schlägt. Selten habe ich einen Film gesehen, der mir in seiner Cineastik so gefallen hat und das bis zum letzten Schnitt, zur letzten Einstellung. Und selten bin ich von einer Story und den Charakteren so enttäuscht gewesen.
Whiplash ist ein Musikfilm. Und er entspricht diesem Genre so sehr wie er vorhersehbar ist. Die Story ist daher schnell erzählt. Ambitionierter Musiker (Miles Teller) trifft auf den Arschlochmentor (J. K. Simmons), der aber nur deshalb jede*n beschimpft, weil er das Meiste aus den Künstler*inn*en rausholen will. Mehr Figuren treffen wir nicht, denn alle anderen sind bloße Plotpoints. Hier hat kein Charakter Tiefe. Vielmehr treffen bloße Tropes auf eine hundertmal gesehene Geschichte.
Der amerikanische (Alb-)Traum
Auch wenn der Film von Damien Chazelle nicht American Sniper heißt, könnte er amerikanischer nicht sein. Denn hier geht es um den amerikanischen Traum. Der Sohn, der aus einer Familie kommt, in der es keine Musiker*inn*en gab – einer Familie, die fast gar nicht verstehen kann, warum er für die Musik brennt. Und es geht um den Kampf. Den Kampf um die beste Leistung. Du musst nur hart genug üben, du musst es nur richtig wollen und dann kannst du der*die Beste sein.
Doch eigentlich ist Whiplash eine Tragödie, denn hier wurde ein großartiges Setting, eine konsequente und wunderschöne Kamera und die besten Schnitte an eine mittelmäßige Story verschwendet, dass einem*r fast die Tränen in die Augen steigen. Selten habe ich Musik so schön inszeniert gesehen. Und es ist spannend diese Musikgeschichte anhand eines Schlagzeugers erzählt zu bekommen. Denn ähnlich wie der*die Bassist*in werden sie oft im Vergleich zu den Künstler*inn*en am Klavier, den Streichinstrumenten oder der Gitarre vergessen. Dabei sind beide – Bass und Schlagzeug – die Basis einer jeden Band.
Eine Ode an den Jazz
Und die Musik. Ach, die Musik. Als ehemalige Saxophonspielerin hatte ich schon immer eine Vorliebe für Jazz. Und der Film feiert diesen Musikstil ungebrochen. Der Film zollt dem Jazz auch damit Tribut, dass die Musik, die wir hören nur von den gezeigten Musiker*inn*en oder der CD kommt. Bis zur letzten Minute steht der*die Musiker*in im Zentrum. Wir sehen Künstler*inn*en, die es wirklich wollen, die an einer der härtesten und besten Schulen Amerikas für ihren Traum kämpfen. Whiplash zeigt uns wie unglaublich hart es ist, Musiker*in auf diesem Niveau zu sein und welchen Preis man* bereit ist zu zahlen.
Aber so gut und vielversprechend diese Prämisse klingt, so traurig ist es, was dann aus dieser Geschichte wird. Weder mag ich das Stereotyp des beleidigenden Lehrers (oder Lehrerin), der*die ohne Rücksicht auf Verluste oder Political Correctness mit Agression um sich wirft, Schüler*inn*en schlägt und alle beschmipft, weil sie da sind. Noch mag ich den Topos des rücksichtslosen Erfolgs. Und damit meine ich rücksichtslos in jeder Hinsicht. Ohne Rücksicht auf die Menschen, die man* liebt, auf das eigene Wohl oder auf die eigene Psyche. Menschen wie Fletcher (eben besagter ‘Mentor’) produzieren nur eins: Weitere rücksichtslose Arschlöcher. Und davon hat diese Welt schon genug.
Arschloch bleibt Arschloch
Natürlich ist es wichtig junge Künstler*inn*en zu pushen. Aber es gibt mehr Abstufungen als a) ich packe dich in Watte ein und sage du warst gut, obwohl du es nicht warst und b) ich terrosiere dich so lange bis du nichts anderes mehr machst als zu üben und ein psychisches Wrack bist.
Und fangen wir gar nicht von Frauen an. Es gibt genau eine Frau in diesem Film. Sie hat drei Szenen und dient nur dazu zu zeigen, was unser Protagonist bereit ist aufzugeben und wie egozentrisch er ist. An sich ist ja gegen eine Mikrostudie nichts einzuwenden. Filme wie Gravity zeigen, dass es funktionieren kann sich auf wenige Figuren oder Thematiken zu konzentrieren, um einen Punkt zu machen. Doch Whiplash gelingt es nicht, Figuren zu zeichnen, die uns wirklich interessieren. Die beiden Hauptfiguren bleiben den ganzen Film nicht mehr als verrückter Lehrer und noch verrückterer Schüler. Die einzig schöne Beziehung die wir sehen, ist die unseres Helden zu seinem Vater und auch diese hat nur einen Zweck, den Plot anzutreiben.
Via flickr by Monica Liu
Der Film ist so vorhersehbar wie ein Notenblatt.
Gepaart mit den ’emotionalen’ Szenen (die z.B. zeigen sollen das auch Fletcher ein gutes Herz hat) und allen Konflikten, die die Situation zuspitzen sollen, lässt Whiplash zumindest bei mir nur Enttäuschung zurück. Denn alle diese Elemente siehst man* meilenweit voraus und lassen eine*n schon fünf Minuten vorher genervt seufzen. Whiplash ist Vorhersehbarkeit par excellence.
Und es ist einfach so schade, denn Miles Teller liefert hier wirklich einen grandiosen Job ab. Auch wenn das Drehbuch nicht wirklich charakterliche Tiefe hergibt, so holt er alles aus dem jungen Schlagzeuger raus. Er schwitzt, er blutet, er spielt sich fast in die Besinnungslosigkeit und das mit einer Intensität, dass ihm niemand mehr unterstellen kann ein einfacher Comedydarsteller zu sein. Auch J.K. Simmons macht wie so oft alles richtig, aber am Ende des Tages ist es immer einfacher den durchgeknallten Bösewicht zu spielen, vor allem wenn er so kompromisslos ist wie Fletcher.
Was bleibt also von Whiplash? Eine verschenkte Chance, die sicherlich den ein oder anderen Preis für den Schnitt oder die Kamera verdient hätte, deren Gesamteindruck aber verblasst gegenüber den anderen Nominierten. Und dann stellt sich die Frage, sollte man einen Film überhaupt prämieren, wenn er so existenziell in seiner Story versagt? Ich kann nur hoffen das Sharone Meir (Kamera) und Tom Cross (Schnitt) noch mal zusammenarbeiten. Nur bitte, bitte mit einem besseren Drehbuch, dann haben wir sicherlich den Film des Jahrzehnts.
Featured Image by SirachV
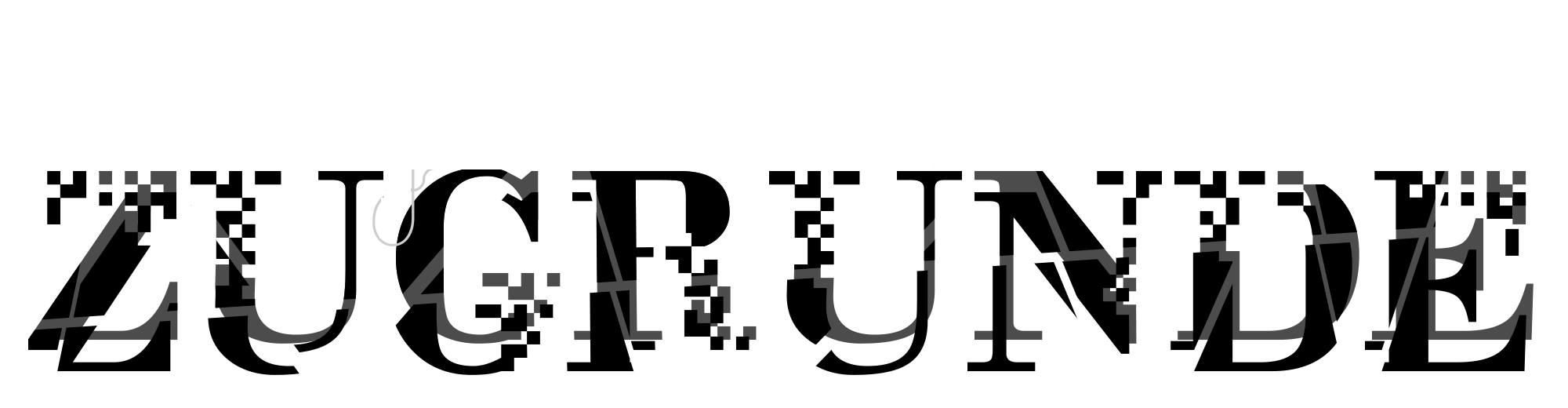





Leave a Reply