Miesmuschel-Max ist zurück! Im Ernst zweifle ich langsam daran, ob ich nicht einfach nur Oscar Animositäten an den Tag lege. „12 Years A Slave“, „The Wolf Of Wall Street“ und „Captain Phillips“ waren für mich allesamt nicht einmal im Ansatz preisverdächtig. Sicher hat jeder dieser Filme seine Besonderheiten, doch auch was konzeptuelle Schwächen angeht, lassen alle drei Filme nicht viele Fettnäpfe aus.
Jetzt bleibt fast nur noch zu hoffen, dass ausgerechnet der Indie-Film „Nebraska“ meine Einstellung zu den Oscars diesen Jahres aufbessern soll. Aber wenn ein Film relativ frei von Druck auftreten können sollte, ist es doch die in Schwarzweiß gehaltene Geschichte von Vater und Sohn, sowie Familie und Geld. Aber auch von mir normalerweise geliebte Vater-Sohn-Geschichten müssen das gewisse Etwas mitbringen, um einen Oscar einheimsen zu dürfen.
Schon der Trailer bereitet auf das sehr langsame Pacing des Films vor…
Wie der Vater…
Rentner Woody Grant büchst regelmäßig von zu Hause in Montana aus und macht sich zu Fuß auf nach Lincoln, Nebraska. Er möchte einen Werbebrief einlösen, der ihm verspricht eine Million Dollar gewonnen zu haben und so etwas Wertvolles kann man natürlich nicht der Post anvertrauen. Ehefrau Kate (June Squibb) und Woodys älterer Sohn Ross (Bob Odenkirk) wollen den senil erscheinenden Mann ins Heim schicken, wogegen der jüngere Sohn David (Will Forte) die Misere irgendwann nicht mehr mitansehen kann und kurzerhand den Roadtrip mit Papa wagt.
Der Film beginnt schon bei dieser Prämisse für die Reise den Spagat zwischen möglichst natürlicher und realistischer Erzählung und klassischer Filmerzählung. Antagonisten und mit ihnen zusammenhängende Ereignisse in der Zukunft werden genau wie die Hintergründe der Charaktere über meist klug in Nebensätzen versteckten Schlüsselwörtern und Phrasen vorgestellt. Mit viel eigener Interpretation und Auffassungsgabe wird aus dem scheinbar unscheinbaren Woody eine tragische Figur.
Komm, ich erzähl dir keine Geschichte
Erst im Laufe des Films offenbaren sich gewisse Charakterzüge Woodys, die der Zuschauer durch und zusammen mit David entdeckt. Das Problem dabei ist, dass David so wenig über seinen Vater zu wissen scheint, dass wir keine ursprüngliche Motivation zu dieser Reise außer Mitleid mit sich selbst und dem eigenen Vater haben. Wo dieses Mitleid allerdings herrührt, kann allein auf gegebene Liebe für Eltern ob all ihrer Fehler zurückgeführt werden.
Wenn David und Woody bei der Verwandtschaft halt machen und diese von Woodys vermeintlichen Gewinn erfährt, wird allerdings genug losgetreten um alle möglichen Familienszenarien durchzuspielen. Wer ist liebendes Familienmitglied, wer ist nur auf Geld aus? Wie hat Woody in der Vergangenheit Leute behandelt und wie behandelten sie ihn. Langsam, sehr langsam enthüllt der Film über all diese Geschehnisse den Protagonisten dieser Geschichte, der tatsächlich ein unglaublich unscheinbares Leben geführt hat. Hier vorweg zu greifen wäre sträflich, da in „Nebraska“ so schon sehr wenig passiert, dass man die wenigen Überraschungen und gut geschriebenen, aber letztlich zu spärlich gesäten Dialoge nicht kennen sollte.
Hauptsache schwarzweiß
Mitten im Leben
Es zeichnet „Nebraska“ aus, dass der Film es schafft eine unglaublich natürliche Atmosphäre über die Dialoge und Handlungen der Charaktere zu schaffen. Viele Dialoge hat man so und ähnlich schon in der eigenen Verwandt- und Freundschaft erlebt, sodass man unweigerlich schmunzeln muss, selbst wenn das typische Verhalten einiger Akteure im echten Leben die Weißglut hervorruft.
Zwar vergisst der Film im Gegensatz zu oben genannten Filmen nicht ein Drehbuch mit klar erkennbarer Spannungskurve zu servieren, doch Alexander Paynes „Nebraska“ ist nochmals eine gute Spur langsamer als der ebenfalls sehr gemächliche funktionierende „The Descendants“. Es ist immer eine Freude, wenn „Nebraska“ starke Momente präsentiert, doch wenn auch nur fünf Minuten ohne kleines Highlight vergehen kommt es Zuschauern wie eine halbe Ewigkeit vor. Einigen – die dann wohl auch „The Descendants“ mochten – werden diesen Stil preisen, da ihnen die Höhepunkte umso prägnanter vorkommen können. Viele wird der Film allerdings durch seine langatmige Ader abschrecken.
Gekonnte Hausmannskost
Es ist nicht allein dem Tempo des Films anzukreiden, dass „Nebraska“ keine Euphoriewelle bei mir ausgelöst hat. Der insgesamt gute Film verlässt sich in seinem Konzept viel zu sehr auf eine Geschichte, die in ähnlicher Form schon unzählige Male erzählt wurde. Der entfremdete Sohn, der seinen Vater näher kennen lernen will, ist eine brauchbare Ausgangssituation, doch die späteren Ereignisse sind allesamt vorhersehbar und lassen eine originelle Idee vermissen.
Auch auf technischer Seite weiß der Film nur bedingt zu überzeugen. Die oftmals in sehr wenigen Kameraeinstellungen gedrehten Szenen nehmen oft mögliche Nähe zu den Charakteren. Besonders wenn Mutter Kate wieder von ihrer wilden Jugend erzählt oder wortgewaltig Verwandtschaft, sowie Gott und die liebe Welt zurecht weist, vermisst man desöfteren ein paar Nahaufnahmen. So zeichnet der Film sich zwar intimer im Sinne eines Indie-Projekts, kann allerdings selten Emotionen mit voller Wucht präsentieren.
Vielleicht gab es Payne in Nebraska auch nicht genug zu sehen
Kunst ist Kunst ist Kunst
Auch die Entscheidung den Film in Schwarzweiß zu drehen bleibt bis zum Abschluss des Films eine fragwürdige Entscheidung. Payne erinnert an die Fotografie, doch bei allen Falten und Profilen, die dieser Film vorzuweisen hat, spielt und nutzt der Film zu selten mit den (eingeschränkten) Möglichkeiten eines Schwarzweißfilms. Warum diese Familiengeschichte nicht auch in saftigen Farben eines „Brokeback Mountain“ hätte zünden können, bleibt wohl auf ewig ein Geheimnis des Regisseurs.
„Nebraska“ ist kein hoch künstlerisches Kino. Es ist auch nicht experimentell. Teils ist der Film sogar so minimalistisch, dass sich der Zuschauer ein, zwei Kameraeinstellungen und Storykniffe mehr gewünscht hätte. Die ereignisreiche und doch sehr zurückhaltend und teils auch distanziert erzählte Geschichte des traurigen Woody Grant bleibt deswegen bis zum Schluss solides, wenn auch wegen technischen Eigentümlichkeiten klobig wirkendes Kino, dass ohne zu langweilen auch niemanden aus dem Sessel reißt.
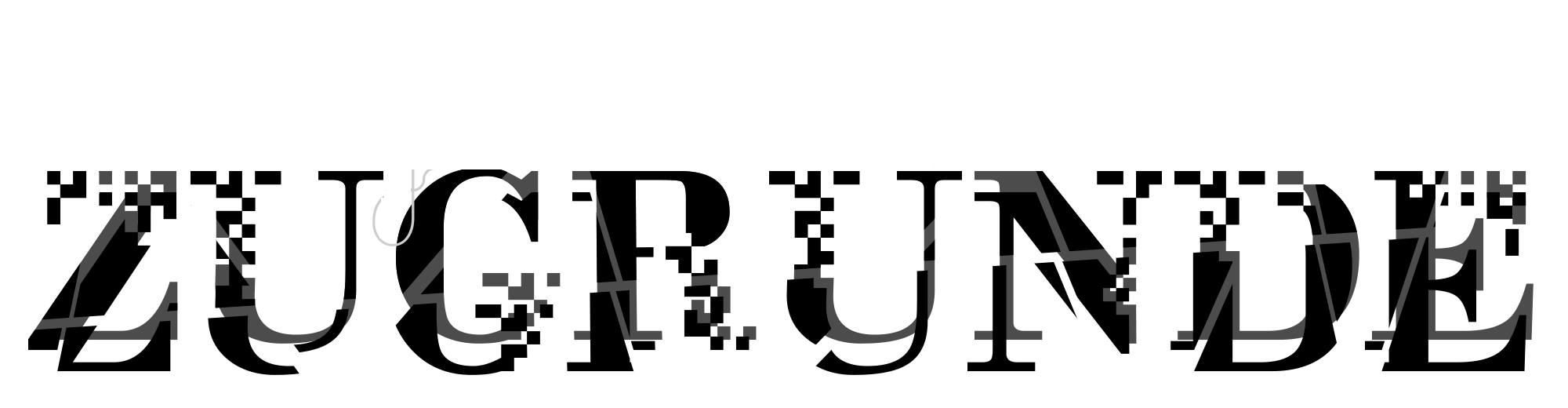






Leave a Reply