Der deutsche Ableger des Online-Magazins gamesindustry.biz hat Christopher Schmitz interviewt, der jetzt als „Director of Production“ bei Quantic Dreams (Heavy Rain, Beyond: Two Souls) arbeitet. Das Interview an sich ist nicht so wirklich interessant, eher ein Beispiel für ordentliche PR, aber die Überschrift springt ins Auge: Wir wären nicht mehr weit vom Fotorealismus entfernt, heißt es dort. Herr Schmitz sagt dann genau anderthalb Sätze zum Stand von Grafik, im Weiteren geht es um die Spiele von Quantic Dream. Die Überschrift aber zeigt nicht nur das Können des Verfassers, klickstarke Headlines zu schreiben, sondern auch die Obsession der Spieleindustrie mit Fotorealismus. Können wir letzteres einfach bitte lassen?
Schauen wir doch mal nach Hollywood: Dort werden CGI (Computer Generated Images) seit einer Mischphase in den 1990ern (z.B. Jurassic Park) mittlerweile fast zum völligen Ersatz für „echte“ Spezialeffekte eingesetzt. Das schreckliche Ergebnis sind völlig übertriebene Katastrophenfilme wie 2012, ein schlicht unecht aussehender Spiderman in The Amazing Spider-Man oder die berüchtigten Star Wars Prequels, die auch Katastrophenfilme sind, nur auf eine andere Art. Selbst hochbudgetierte Filme sind nicht vor schlechten Effekten sicher, denn: Digitale Effekte sehen immer nach Bildern aus dem Computer aus. Vor allem, wenn wir als Zuschauer*innen den direkten Vergleich mit realen Schauspieler*innen und Kulissen haben. Nicht ohne Grund gibt es zahllose Videos, welche die schlechtesten Computereffekte aufzählen. Gleichzeitig gibt es Regisseure wie Christopher Nolan, welche CGI und praktische Effekte ziemlich beeindruckend kombinieren.
Der Film, für viele ja leider noch immer das liebste Vergleichsmedium mit Videospielen, zeigt also, dass Computerbilder immer gegen die Realität abstinken werden. Und in der Tat merken wir schnell wenn Grafik versucht, die Realität zu simulieren, auch bei den Bildern aktueller Engines. So gibt es von der neuen Unreal Engine einige Videos, welche den Fotorealismus des Grafikgerüsts unterstreichen sollen. Leider versagen sie dabei.
So wirkt das Abbild von matten Oberflächen (Polstern und Teppichen) noch halbwegs realistisch, bei glänzenden Dingen wie den Lackregalen oder der Küche versagt das Rendering allerdings. Dies fällt umso mehr auf, je näher an der Wirklichkeit die Grafik sein soll.
Wie sollen die Grafiker*innen das auch schaffen? Wir Menschen sehen jeden Tag um uns herum, wie wenig glänzend und perfekt die Wirklichkeit ist. Und wir sehen sie in Bewegung und selbst bei Spielen sitzen wir auf der Couch oder im Sessel, schauen dabei auf einen Bildschirm und zocken uns die Finger wund. Schaut euch meinen Schreibtisch an: Die Wirklichkeit ist dreckig, schlecht beleuchtet, voller unnützem Kram und total unaufgeräumt. Wenigstens hab ich aber eine schicke Mütze.
Darüber hinaus rechnet sich Fotorealismus wahrscheinlich auch nicht. Denn dazu braucht es viel Geld und ebenso viel Rechenkraft, welche die PS4 und die Xbox One einfach nicht haben (auch wenn sie wahrscheinlich mehr Leistung bringen können als mein PC). Warum also eine Armee an Grafiker*innen daran setzen, möglich realistische Texturen und Beleuchtung einzurichten, wenn das Geld genauso gut in eine wunderbare Story oder gutes Spieldesign fließen kann?
Nicht zuletzt bleibt der Knackpunkt beim Streben nach Fotorealismus schließlich der Mensch selbst. Zwar zeigen Titel wie L. A. Noire oder Call of Duty: Advanced Warfare, dass digitalisierte Schauspieler durchaus eindrucksvolle Leistungen in Spielen erbringen können, aber auch hier wird vielen Zuschauer*innen deutlich: Es ist nur ein Spiel. Und dieses Bewusstsein kann schnell das Ziel der Immersion kaputt machen, weil sich die Spieler*innen im sogenannten „Uncanny Valley“ verirren. Diese Theorie besagt aber auch: Je abstrakter ein Wesen daher kommt, so denn es nur „menschlich“ genug gezeichnet ist, desto höher ist auch unsere (emotionale) Akzeptanz des Wesens. Statt also beständig zu versuchen, „echte Menschen“ grafisch in einem Spiel abzubilden (hallo, Quantic Dreams), sollten sich die Produzierenden lieber darum bemühen, ihre Figuren möglichst menschlich und zugänglich zu gestalten.
Ausserdem: Oftmals wirkt eine reduzierte, aber stilsichere Grafik weit zeitloser als der neueste Griff nach den unerreichbaren Sternen der Realität. Denken wir mal an XCOM: Enemy Unknown. Dessen Grafik ist simpler, comicartiger, aber genau deshalb lässt sich das Spiel auch in zehn Jahren noch spielen, ohne Augenkrebs zu bekommen. Oder nehmen wir Mirror’s Edge: Durch geschickte Beleuchtung und spärliche Farbgebung wird eine weit stärker „fassbare“ (Wortspiel!) Welt erschaffen als bei anderen Spielen. Vor allem Indie-Titel zeigen oftmals, dass auch ohne Raytracing, Bump Mapping und Ambient Occlusion ein fesselndes, immersives Spiel entstehen kann.
Also, liebe Entwickler*innen: Lasst doch den Fotorealismus einfach als nette Idee und Ziel für Grafiktüftler bestehen, entwickelt eure Spiele aber lieber mit einem guten Design in Sachen Grafik und Story. Als Beispiel kann da ruhig Quantic Dreams und sein „Director of Production“ (was für ein blödsinniger Titel!) dienen: Der redet im Interview schließlich auch mehr über die Geschichten seiner Spiele als deren Grafik.
Featured Image by Lori Semprevio
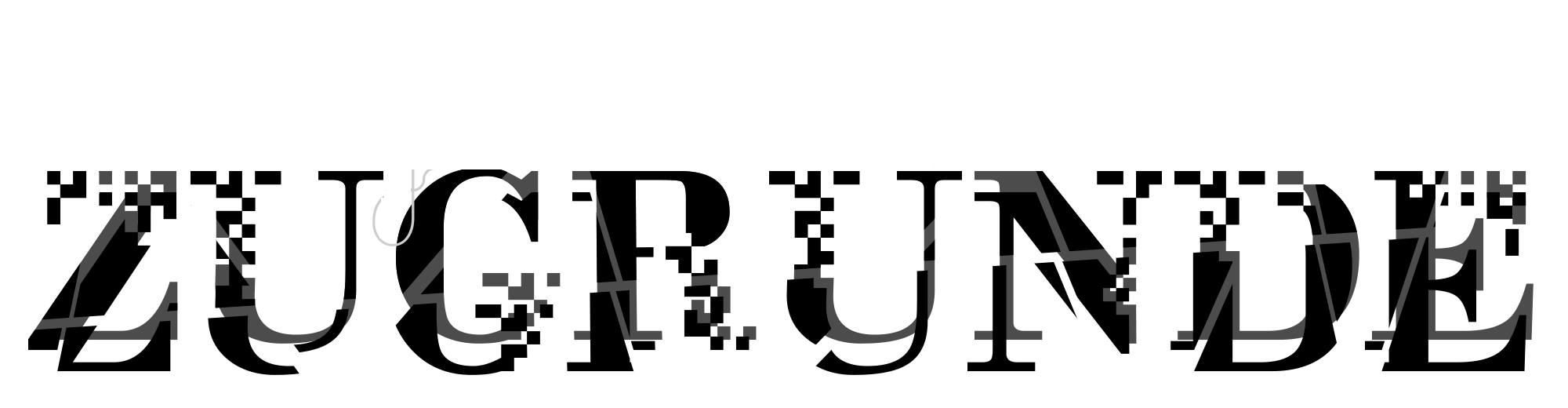





Leave a Reply