Was ist dieses Jahr nur los? Filme werden immer besser gemacht. Effekte, Kamera- und Schnittarbeit sind im digitalen Zeitalter auf einem ganz neuen – wenngleich nicht unumstritten – Level. „Dallas Buyers Club“ setzt auf knackige Schnitte und „Captain Phillips“ versucht die Intensität der Bigelow-Filme zu toppen. Auf technischer Seite werden die großen Ringkämpfe ausgefochten. Drehbuchautoren sammeln weiter Magic-Karten und spielen im dunklen Keller, während die – ebenfalls unterbezahlten – Techniker mit den Löwenanteilen spielen dürfen.
Das ist natürlich lediglich eine Metapher. Einige der Drehbuchautoren der ganz großen Filme verdienen vielleicht sogar richtig gut. Ob das über Verbindungen, den Ruf oder tatsächliche Leistungen festgelegt wird, ist nur schwer einsichtig. Ich für meinen Teil bin leider ziemlich unzufrieden mit den diesjährigen Leistungen einiger Drehbücher. Und ohne zu verlangen, dass die besten Filme auch immer für das beste Drehbuch nominiert sein müssen, ist der Inhalt eines Films immer noch das Herz der Angelegenheit.
Leonardo Di Caprio… not winning the Oscar since 1998
Birth of a Salesman?
Wer meine Reviews zu „Captain Phillips“ und „12 Years a Slave“ gelesen hat, der kennt meine Kritik an unfokussierten Drehbüchern. Die Filme erzählen ihre Geschichten ohne echte Dramaturgie. Weder handelt es sich um klassisch in Akten erzählte noch Rise & Fall Geschichten. Die Filme geschehen einfach. In eine ähnliche Schublade fällt auch „The Wolf of Wall Street“. Im Gegensatz zu den vorigen Filmen wird sich nicht auf möglichst intensive Momente, sondern heftige Dialoge konzentriert (und eine verdammt abgedrehte Drogenexzess-Szene, die Kokain mit Popeyes Spinat gleichsetzt).
Das war es im Grunde auch. Damit ist der Film erzählt. Ihr wisst noch gar nicht worum es geht? Geld korrumpiert. Das wird zu Beginn auch richtig stark erzählt. Typisch Scorsese wird mit Videocollagen und inneren Monologen gearbeitet. Dazwischen erklärt Matthew McConaughey dem noch jungen Leonardo DiCaprio die Finanzwelt. Fick den Kunden, nutz’ den Limbo des imaginären Geldes an der Börse und werde so reich wie möglich. Ohne falsche Bescheidenheit und ohne die Charaktere zu attackieren erzählt der Film von abgrundtief kapitalistisch gesteuerten Individuen, die in ihrer Lust auf Geld und Macht zu degenerierten Anzügen verkommen.
So viel Macht und doch so wenig Punkte bei Scrabble – wie ungerecht die Welt doch sein kann!
Momentaufnahme ohne Bezug
Für gut 90 Minuten funktioniert dieses Spektakel richtig gut. Wie DiCaprio einem Finanz-Erlöser gleich seine soon-to-be Gefolgsleute die Kunst des Brokerdaseins lehrt und Höhlenmenschen des 20. Jahrhunderts das wirtschaftliche Feuer bringt. Warum eigentlich nur Erlöser? DiCaprio spielt den Schöpfer des modernen überkompetitiven Börsianers. Und dann kommt der Cut. Der Film dreht sich um Privatleben, zerstrittene Ehen und Exzesse aller Art. Eine gute Stunde bewegt sich der Film nicht mehr weiter und kratzt nur noch an den unterhaltsamen Eskapaden rund um das Börsengeschäft.
Es dauert bis eine Dreiviertelstunde vor Schluss bis der Film lose Storystränge aufgreift, um dann FBI, das Schweizer Geheimkonto und die Drogenprobleme auf einen Schlag auf das Drehbuch loszulassen. Anstatt den Hörer effektiv wegzublasen, übertreibt dieses filmische Fortissimo auf allen Ebenen. Keiner der Charaktere ist konsequent in seinen Handlungen und die Ereignisse sind ebenso weit hergeholt.
Belohnt wird der Zuschauer dann allerdings mit dem gleichen Juwel wie zu Beginn. Eine gut gestreckte Collage, die mit einem irrwitzig geschriebenen Monolog DiCaprios untermalt wird. Das ist gutes Filmemachen. Nur ist es nichts Besonderes. Scorsese zitiert sich selbst und verpasst es eine Chronik wie in „Aviator“ oder eine packende Geschichte à la „The Departed“ zu erzählen. Da helfen auch keine irrwitzigen und brillanten Szenen. So bleibt „The Wolf of Wall Street“ nur im Kurzzeitgedächtnis. „Weißt du noch… die Szene!?“, werden besonders junge Männer sich gegenseitig an einen Film erinnern, der nur von Momenten lebt und das große Ganze vergisst.
Warum sage ich überhaupt noch etwas zu Trailern?
Das Leben des Jordan Belfort < Wall-Street-Megalomanie
Würde der Film das Zwischenmenschliche quantitativ reduzieren und sich eben um den Aufstieg und Fall des Charakters Jordan Belfort (DiCaprio) kümmern, dann wären wir im Geschäft um einen der stärksten Filme des Jahres. Nicht neu, aber richtig stark wird in den ersten knapp 90 und den letzten 45 Minuten die Geschichte eines großen Zahnrads im Wall-Street-Wahnsinn erzählt. Dass der Film sich eine gute Dreiviertelstunde in seiner Selbstherrlichkeit suhlt, kommt dem Film zu keinem Zeitpunkt entgegen.
Und dass jetzt die vierstündige Fassung des Filmes aussteht zeigt, dass der Film sich seiner eigenen Probleme nicht bewusst ist. Technische Brillanz und clevere Momente sind ohne großes Ganzes meiner Meinung nach nicht alleine fähig Großes zu leisten. Am besten vergleicht sich der Film mit einer schlecht gemischten Pralinenschachtel, die ein paar Highlights und viel Vergessenswertes liefert.
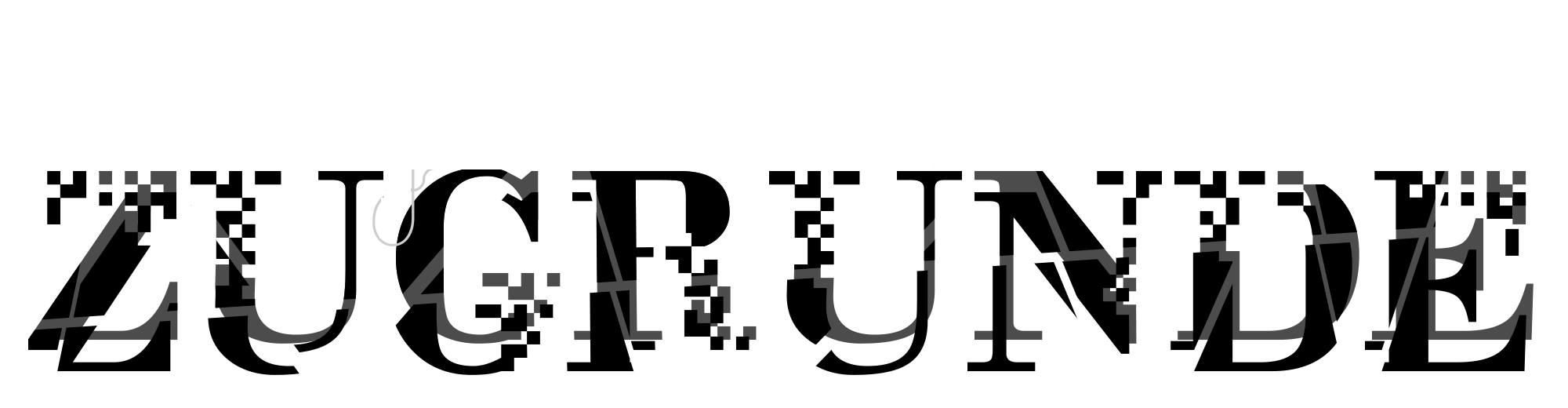






Leave a Reply