Im letzten Podcast hatten Max, Walde und ich versucht, möglichst knapp aber mit angemessener Ausführlichkeit das weite Feld der Indiespiele zu beackern. Inwiefern dieses Unterfangen fruchtbar war, davon könnt ihr euch hier selbst überzeugen. Mir persönlich ist dabei leider ein Aspekt etwas zu kurz gekommen, dem ich diesen Blogeintrag widmen möchte: Dem Verhältnis von Indiespielen und der Debatte ob Videospiele Kunst sein können oder nicht.

Diese Katze kontempliert gerade die Stellung von Arcadeautomaten der frühen 1980er in der populären postmodernen Kunst der frühen 2000er und deren Rückbezug auf die antike Vasenmalerei der attischen Halbinsel zwischen 500 und 300 v. Chr. Via jenbooks
Zunächst muss ich vorher aber natürlich auf Max’ Blogeintrag verweisen, in dem er besagte Debatte für euch etwas aufrollt. Der Kernpunkt dieses Streits um Kunst oder Nicht-Kunst lässt sich darauf reduzieren, dass Kunst letztlich im Auge der Betrachtenden liegt und grobe Generalisierungen (Film ist Kunst! Malerei auch! Comics nicht! Warum? Keine Ahnung! Weil, halt!) eher zu vermeiden sind. Vielleicht lässt sich Kunst auch erst im Nachhinein feststellen. Niemand geht in einen Film oder schaut sich ein Bild an und weiß von vorneherein „Aha, nun konfrontiere ich mich mit Kunst!“ Viel eher entsteht doch Kunst durch die bewusste Reflexion über das Werk und die Frage, welche Auswirkungen dieses Dingsbums auf unser Leben, Denken oder Fühlen hat. Kunst entsteht letztlich also (vielleicht) durch die Interaktion mit dem Werk, sei sie nun aktiv, passiv oder rein intellektuell.
Soviel meine Gedanken zum Thema Kunst und bevor ich mich jetzt anhöre wie ein Kulturwissenschaftler kehre ich mal schleunigst zum eigentlichen Thema zurück: Indiespiele. Wenn man über Kunst redet, fallen den meisten Menschen wahrscheinlich direkt Bilder ein, seien sie die „alten Schinken“ wie von Rembrandt oder Da Vinci, oder die neueren Werken von Miro, Warhol oder Malewitsch. Auch Videospiele machen vor diesem Primat des Visuellen nicht halt: Betrachtet man die erfolgreichen Indiespiele, dann fällt auf, dass sie alle einen eigenen, bestimmten Grafikstil verfolgen. Minecraft hat den reduzierten Retro-Look im Mainstream verankert, Limbo auf einen starken Licht/Schatten-Kontrast gesetzt, Super Meat Boy schlug in die gleiche „Old School“-Kerbe wie Mojangs Millionenhit und weckte wohlige Erinnerungen an die Zeit der 8- und 16-bit Plattformer. Jüngere Beispiele wie Rock of Ages orientieren sich an den Zeichentricktechniken der Monthy Python-Animationen, Botanicula und Machinarium sind in einem ähnlichen Zeichenstil entworfen, welcher irgendwo zwischen Neugier, Faszination (Botanicula) und fröhlicher Melancholie (Machinarium) liegt. Defcon und sein Nachfolger präsentieren die absurd hohen Opferzahlen eines nuklearen Krieges in der klinischen Form einer NATO-Übung und Trine nimmt der geneigten Spielerin und dem geneigten Spieler fast den Atem vor lauter grafischen 2½D-Opulenz. Es ist also das visuell in sich stimmige Design, welches diese Spielen, die alle nur Vertreter des Meta-Genres „Indiespiele“ sind, letztlich von den AAA-Titeln des Massenmarktes abhebt.
Denn die großen Marken versuchen immer stärker auf Photorealismus und grafischen Bombast zu setzen (z.B. Crysis oder die Damen und Herren von Rockstar), einem Ziel, das sie wohl nie erreichen können. Im Falle von Ego-Shootern, zumindest den aktuellen „Modern Warfare“-Clones wie Medal of Honor, Battlefield 3 usw. hat dies zu einer gewissen „realistischen“ Farblosigkeit geführt, dominiert von Grau, Oliv und Beige. Zwar mag dies dem gewünschten Grad an Realismus entsprechen, der visuellen Stärke des Mediums Videospiele gereicht dies aber nur schwerlich zur Güte. Da haben Spiele mit phantastischem Hintergrund, wie Painkiller oder jetzt Halo 4, bessere Karten.
Aber Indiespiele heben sich auch jenseits der Grafik von der restlichen Masse an Titeln ab. Auch mechanisch überzeugen sie oft. Denn meist konzentrieren sich die genannten Titel auf einen bestimmten Aspekt, welcher mit allen Facetten und dem ganzen Können der Crew zur Blüte gebracht wird. Bei Trine sind es die Physik-Rätsel, ähnlich wie in Braid und Limbo. Super Meat Boy ist Jump ‘n Run par excellence, To The Moon ist eigentlich eine pseudo-interaktive Geschichte und Amnesia erzeugt eine Stimmung, welche so dicht und schnittfest ist, dass empfindliche Gemüter wie ich es nicht länger als eine Stunde aushalten. Die hochbudgetierten Massenspiele müssen dagegen im besten Falle mehrere Spieler*innentypen gleichzeitig ansprechen: Hier brauchen wir was für den Rollenspieler, dort für die Actionspielerin, hier eine Prise Taktik und Strategie, dort bitte noch eine Schleicheinlage einfügen und kriegen wir hier hinten noch mal etwas Horror hinein? Bestes Beispiel hierfür ist die Assassin’s Creed-Reihe, welche in ihren Sequels immer neue Aspekte aus anderen Genres mehr oder weniger halbherzig eingeführt hatte, um auch jedes noch so kleine Marktsegment zu befriedigen und für maximale Abwechslung zu sorgen. Herausgekommen ist dabei aber eine ab dem zweiten Teil etwas fade schmeckende Brühe, die nach ein paar Spielstunden anfängt, sauer zu riechen.
Indiespiele hingegen verfolgen eine bestimmte, fast künstlerische Hingabe an ein bestimmtes Ziel und können deshalb so fesseln. Sie unterliegen nicht dem Zwang, Kompromisse in ihrem Spieldesign eingehen zu müssen und können sich deshalb auf ihre Stärken konzentrieren und ihre Schwächen in Kauf nehmen. Aber diese Schwächen werden sehr oft von der brillanten Umsetzung der Mechaniken oder Konzepte überstrahlt und fallen deshalb weniger auf.

Außer Spore. Spore hatte immense Schwächen. Aber deshalb war’s ja auch kein Indiespiel. via anitakhart
Nicht zuletzt ist Kunst auch immer zuerst solides Handwerk: Kein Maler, der nicht ordentlich malen, kein Musiker der nicht ordentlich sein Instrument beherrscht, kann hohe Kunst schaffen. Das Entwerfen von Spielen ist ebenfalls ein Handwerk und wenn alle Teile stimmen und ein solches Spiel, egal ob nun Independent oder Triple A, in sich ein stimmiges Bild abgibt, dann, ja dann können auch so eigentlich alberne Dinge wie Videospiele Kunst sein. Aber meiner Meinung nach geht die ganze Debatte um Kunst oder Nicht-Kunst am Kernpunkt von Videospielen vorbei. Die eigentliche Frage lautet doch: Macht es Spaß? Denn darum geht es doch letztlich beim Spielen: Spaß zu haben und, in Anlehnung an Friedrich Schiller, im Spiel ganz Mensch zu sein.
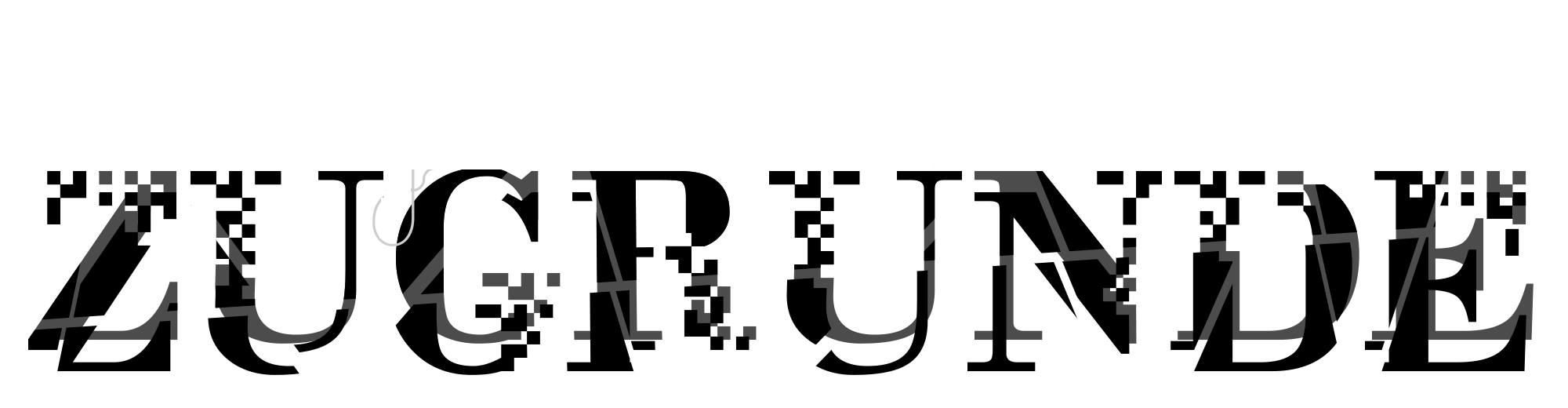




Leave a Reply