Es gibt etwas, das uns Menschen verbindet. Erfahrungen, die wir alle machen. Menschen überall werden groß, werden “erwachsen” und lernen etwas über Liebe, über Freundschaften, Trennung, Eltern, das Bild von sich selbst und dem Bild, das andere von einem haben. Wir alle kommen mit Narben, aber auch mit glücklichen Erinnerungen aus unserer Kindheit.
Das Genre der Coming-Of-Age-Filme hat sich diese kollektiven Erlebnisse zu Eigen gemacht und kleidet sie immer wieder in das Gewand von Geschichten, die sich um die oben erwähnten Themen drehen. Gleichzeitig aber verpasst dieses Genre den Erfahrungen des Aufwachsen ein eigenes Narrativ. Unsere Vorstellungen von den ersten Malen der Jugend (der erste Kusse, der erste Rausch, der erste Sex, die erste Trennung, das erste Mal richtig Scheiße gebaut, usw.) sind geprägt von diesen kollektiven Bildern, welche Medien aller Art uns eingepflanzt haben. Die Linie zwischen den Übergangsritualen (der erste Kuss, der erste Rausch… ihr wisst schon), die wir freiwillig mitmachen und erst im Nachhinein als Grenzübertritt identifizieren, sowie den Ritualen, die wir nur mitmachen, weil wir gesehen haben, dass Menschen in Büchern und Filmen das auch gemacht haben – diese Linie ist sehr dünn geworden.
Die Bühne des Lebens – und der Orchestergraben der Pubertät
Zudem gibt es bestimmte Zäsuren im Leben der meisten Jugendlichen: Der Schulabschluss, der erste Job, wahlweise das Studium, das erste Konzert… Diese “großen Szenen” sind ein fester Bestandteil der Jugend-Narrative unserer Zeit geworden. Aber was sagen sie noch aus? Überstrahlen sie nicht die eigentliche Entwicklung, die nebenher, Abseits des Rampenlichts stattfindet? Es wäre also angebracht, stattdessen auf die kleinen Szenen zu setzen, auf die Alltäglichkeiten, die so oft viel mehr über einen Menschen aussagen als die großen Gesten. Warum auch nicht gleich nebenbei ein ziemlich beklopptes Projekt starten und den Coming-Of-Age-Film mal ganz wörtlich verstehen?
Via Flickr, by Matthias Kümpel
Auch wenn die Gefahr besteht, dass niemand weiß, wo man* später landet.
Der Regisseur Richard Linklater hat wohl keine Angst vor Ungewöhnlichem. Seine Filme Waking Life und A Scanner Darkly bestechen beide durch die ungewöhnliche Rotoskop-Optik und setzen auf ausschweifende Dialoge. Die Before-Triloge (Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight) lebt von seinen beiden Hauptdarstellern, die in ununterbrochenem Fluss reden und sich so näherkommen. School Of Rock wiederum ist eine Hommage an die gute, alte, handgemachte Rockmusik der 70er und 80er-Jahre – und wahrscheinlich aus Linklaters Not geboren, auch mal Geld mit seinen Filmen zu machen.
Der Regisseur startete vor 14 Jahren ein ungewöhnliches Projekt: Er begleitete einen siebenjährigen Jungen (namens Mason Jr.) über die nächsten zwölf Jahre mit der Kamera, schrieb mit und um ihn Szenen, ließ sich jedes Jahr neu einfallen, wo es mit dem Kind, das irgendwann keines mehr ist, hingehen soll. Zur Seite standen ihm Ethan Hawke als Vater des Jungen, Patricia Arquette als die Mutter und Lorelei Linklater (Linklaters Tochter) als Masons Schwester. Ein ziemliches Mammutprojekt, dass allein aufgrund seiner Größe und der Entschlossenheit, es all diese Jahre durchzuziehen, einen Eintrag in die Filmgeschichte verdient. Klar, es gab auch bereits zuvor ähnliche Projekte, teils fiktiv, teils dokumentarisch. Aber nie so stringent durchgezogen wie bei Boyhood.
Erwachsenwerden ist eine Lüge
Glücklicherweise ist Boyhood dabei kein typischer Coming-Of-Age-Film. Denn die angesprochenen, kollektiven Erfahrungen spart er aus und präsentiert uns kleine und größere Szenen, die im Grunde alle für sich stehen. Zum Beispiel wären in jedem anderen Filmdrama Mason Jr. und seine Schwester von der Erfahrung eines trunksüchtigen Stiefvaters, der verquere Machtspiele mit der Familie treibt, schwer gezeichnet. Aber in Boyhood ist diese Szene nur eine von vielen. Und am Ende wird klar: Es geht bei Boyhood weniger um diesen einen Jungen, es geht um die Familie. Um Veränderung. Um die seltsamen Kurven und Pfade, die das Leben beschreibt. Es sind, das zeigt uns Boyhood deutlich, nicht die großen Gabelungen der Veränderung, die offenbaren, wer wir sind, sondern die kleinen Dinge, die auf dem Pfad dorthin passieren.
Eine der stärksten Szenen des Films kommt gegen Ende, als Mason Jr. endgültig bei seiner Mutter auszieht. Mit dem Umzugskarton steht er im Flur, als seine Mutter plötzlich in Tränen ausbricht. “Ich dachte immer, mein Leben ist eine Reihe von Meilensteinen”, schluchzt die Mutter, “Hochzeit, Geburt, Scheidung, deine Schwester geht auf’s College, du gehst auf’s College… Was bleibt mir noch?” Mason schaut hilflos auf seine Mutter. “Mein Begräbnis!”, ruft sie und sackt in sich zusammen. “Ich dachte, da wäre mehr.” In diesem Moment wissen die meisten jungen Erwachsenen, wie sich ihre Eltern fühlen müssen, nachdem der eigene Nachwuchs aus dem heimischen Nest ausgeflogen ist. Und klar wird auch: All diese “großen Momente” wie Schulabschluss oder die erste Arbeit, die sind nur eine künstliche Barriere zwischen dem Aufwachsen und dem Älter werden. Das Erwachsensein ist nur Schall und Rauch, in Wahrheit wissen die meisten Erwachsenen selbst nicht, was sie tun. Mason stellt kurz vor dem College seinem Vater die Frage, wie dieser das alles regelt, mit der neuen Frau und ihren konservativen Eltern, dem neuen Nachwuchs, die Wandlung vom erfolglosen Musiker zum Versicherungsvertreter. Sein alter Herr zuckt nur mit den Schultern: “Wir improvisieren alle nur”. Erwachsensein ist eine Lüge. Das einzige, was existiert, ist die beständige Veränderung.
Kurzum: Guter Film
Boyhood ist ein Film über viele Dinge, aber in erster Linie über Familie. Aber auch über Zeit, über die USA, über das Aufwachsen dort. Die Mutter arbeitet sich von der Alleinerziehenden an der Armutsgrenze hoch zur Collegeprofessorin, scheitert aber an ihren Lebenspartnern. Der Vater verfolgt seinen Musikertraum, gibt diesen aber zugunsten eines bürgerlichen Lebens in Sicherheitsidylle auf. Beide schaffen also ihre Version des amerikanischen Traumes, allerdings nicht so wie sie es sich vorgestellt haben. Im Zentrum steht dabei keinesfalls das große Narrativ, sondern eher die Verwunderung darüber, wo man am Ende gelandet ist. Und die eigene Fähigkeit, Frieden damit zu schließen.
Nach all dem elegischen Gesülze: Ist Boyhood nun ein guter Film? Ja, ist er, eine uneingeschränkte Empfehlung, einfach weil er gleichzeitig auch ein einzigartiges Experiment darstellt. Sollte Boyhood einen Oscar bekommen? Von mir aus ja. Aber gibt es nicht wichtigere Dinge?
Ich glaube, ich rufe jetzt mal meine Mama an und frage, wie es ihr geht.
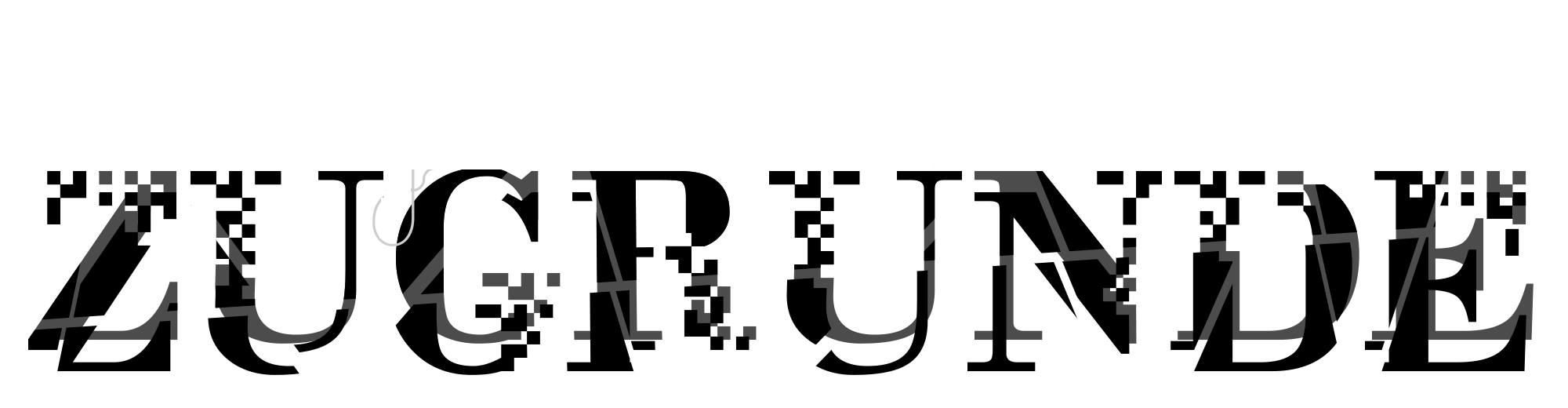





Leave a Reply