„12 Years A Slave“ ist ganz großes Kino. Damit ist allerdings in erster Linie nicht der Film, sondern die Produktion gemeint. Ridley Scott und Brad Pitt als Produzenten und eine Schauspielerriege, die mit Paul Giamatti, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Paul Dano und eben Brad Pitt bis in die kleinste Nebenrolle mit großen Namen gespickt zu sein scheint, versprechen einen Epos. Zusammen mit dem britischen Regisseur Steve McQueen und dem emotional ins Zentrum gerückten Duo Chiwetel Ejiofor und Lupita Nyong’o sorgt der Film mit der Thematik der Sklaverei für ordentlich Oscar-Zunder, da historisch belegtes Leid durch verachtenswerte Unterdrückung scheinbar immer gut kommt (siehe Filme über das dritte Reich).
Das führt uns auch gleich zu dem Film, der mir während des Guckens von „12 Years A Slave“ immer wieder durch den Kopf schoss (phrasing!). Wer erinnert sich nicht an das wohlig bittersüße Gefühl und die aufkommenden Tränen, wenn am Ende von „Schindlers Liste“ Steine auf Oscar (höhö) Schindlers Grab gelegt werden? Diese und alle anderen großen Emotionen lässt McQueens „12 Years A Slave“ aus. Ob es an der Buchvorlage liegt, sei dahingestellt, denn ein Film muss für mich als Film funktionieren. Und das gut zweistündige Leid des Solomon Northup wird leider ohne erzählerisches Konzept erzählt, was Grauen sowie Erlösung nie den Raum und die Kraft gibt, die diese Elemente vorweisen könnten.
Der Trailer war so viel versprechend…
Während der Trailer uns eben eine emotionale Geschichte um die Sklaverei verspricht, ist der Film die Chronik eines einzelnen Mannes, die sehr unangenehm und ohne Rücksicht auf Beschönigung Leid und Unrecht darstellt. Kleine, aufhellende Momente, die in „Schindlers Liste“ und „Das Leben Ist Schön“ das Leid nicht nur ertragbar machen, sondern es umso verstörender und emotionaler transportieren fallen in diesem Film komplett flach. Stellvertretend dafür ist eine Bootsfahrt auf welcher Michal K. Williams (The Wire, Boardwalk Empire) einen Aufstand anzetteln möchte, um nach drei Minuten Screentime abgestochen zu werden. Dieses Ereignis findet einfach statt und lässt den Berg der Hoffnungslosigkeit ansteigen. Eine Moral oder weiterführende Gefühle lässt so eine Szene allerdings nicht zu.
Die Hilflosigkeit der Sklaven und die unterwürfige Abhängigkeit gegenüber ihren Besitzern wird deutlich dargestellt. Auch die Sklavenhändler werden wie eiskalte Geschäftsmänner dargestellt, die ihre Taten nicht bereuen, sondern einem angesehenen, legalen Gewerbe nachgehen. Der Film versucht über Benedict Cumberbatch einen Charakter darzustellen, der trotz Sklavenhaltung Respekt und Menschlichkeit verkörpern soll. Doch dass der von Cumberbatch gespielte Mr. Ford letztendlich immer noch ein Feigling ist, der den Gepflogenheiten folgt und selbst brutale Aufseher beschäftigt, lässt der Film neben Cumberbatch-Huldigungen (und dass dieser keinen Südstaatenakzent beherrscht) geradezu fahrlässig aus.
Neben vielen, wenig aussagenden Nahaufnahmen und singenden Sklaven kümmert sich der Film auch wenig um den Alltag der Sklaven. Viel mehr dreht sich der Film um Höhepunkte des Schmerzes während Solomons Zeit als Sklave. Diese Szenen werden jedoch durchgehend von Michael Fassbender getragen, der einen hassenswerten Bastard verkörpern soll, durch die fehlenden Motivationen seitens des Drehbuchs allerdings nicht mehr als ein unausbalancierter Südstaatler ist, der wie die meisten anderen Charaktere im Film Sklaven als Eigentum ansieht, die keine menschlichen Rechte haben.
Genau diesen einen Punkt hat der Zuschauer allerdings nach einer halben Stunde verstanden. Danach hangelt sich der Film von einer leidvollen und unangenehm zu beobachtenden Szene zur nächsten und rückt wegen scheinbar mangelndem Material auch die Geschichte der Sklavin Patsey (Lupita Nyong’o) in den Mittelpunkt der zweiten Filmhälfte. Die Auspeitschungen und Vergewaltigungen sind allerdings zu diesem Zeitpunkt nur noch Kirschen auf dem Eisbecher aus Leid, an welchem sich der Zuschauer längst satt gegessen hat.
Und wer darf am Ende den Helden spielen…?
Ein jüngeres Beispiel für filmische Dramatik zu echten Ereignissen haben letztes Jahr „Lincoln“ und natürlich Oscar-Gewinner „Argo“ präsentiert. Steven Spielberg, Ben Affleck und deren Drehbuchautoren haben es verstanden die Wirklichkeit so zu präsentieren, dass Botschaften hängen bleiben und die Zuschauer bewegen. Die finsteren Seiten der Menschheit wurden stets durch Humor, Intelligenz und gekonnte Dramaturgie konterkariert und auf die Spitze getrieben. So Mainstream sich das für manche anhört, sind dies einfach Grundvoraussetzungen, um gute Geschichten zu erzählen.
„12 Years A Slave“ verliert sich in der eigenen Größe seiner Geschichte und kann weder das Ausmaß der Geschichte komprimieren, noch bekommt es seine vielen Cameo-Auftritte unter Kontrolle, die stets von der eigentlichen Hauptfigur des Films ablenken. Leider bewegt sich der Film aufgrund der wirklich außerordentlichen Produktion und brisanten Thematik in Sphären, die kaum jemand kritisieren wird. Als Film versagt „12 Years A Slave“ nicht und bringt einige gute schauspielerische Leistungen hervor (allen voran allerdings nicht Ejiofor, sondern Fassbender), doch aufgrund fehlender Struktur und nicht vorhandenen Botschaften, die uns tatsächlich mit dem Thema der Sklaverei konfrontieren oder Menschlichkeit in uns wecken, ist der Film nicht mehr als Hochglanz-Mittelmaß.
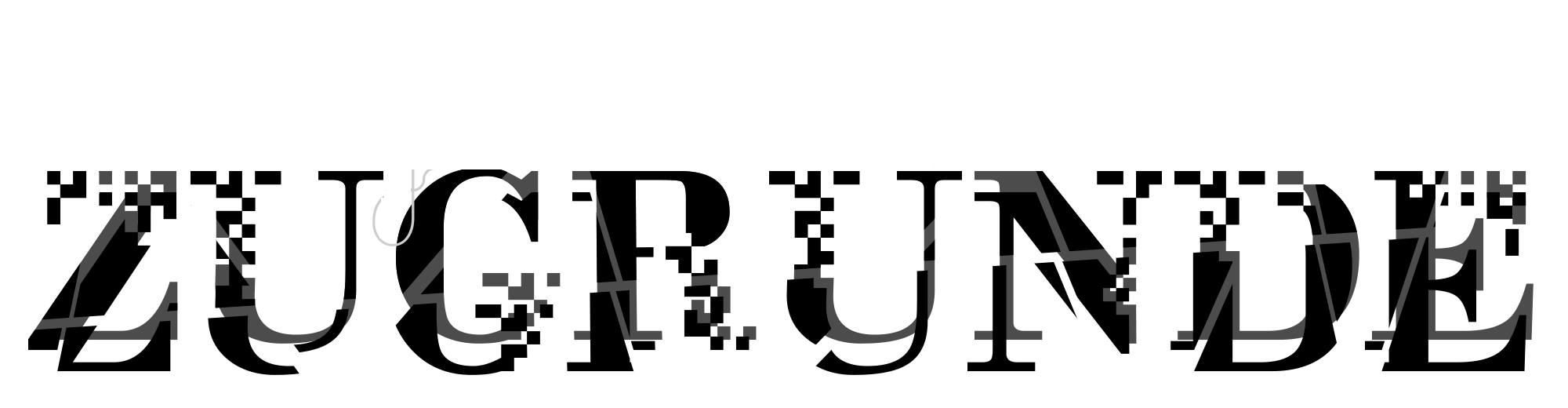





Leave a Reply