Mit dem Berlinaufenthalt verhält es sich ein wenig so, wie mit dem ersten Sex. Das Ereignis an sich muss (und wird oftmals ohnehin) nicht sonderlich befriedigend ausfallen, aber man kann endlich behaupten, dass man es getan hat. Obwohl die Hauptstadt mittlerweile ganz andere Sorgen hat, als sich damit zu beschäftigen, den Ruf als amüsante Spielwiese für jene, deren Konzeptlosigkeit in anderen Städten einfach keine Früchte tragen würde, zu wahren, klingt das Fernweh vieler junger Menschen nicht ab und der Mythos um die deutsche Großstadt ist nicht tot zu kriegen. Gerade in Trier macht sich das Streben nach dieser inländischen, aber trotzdem vermeintlich anderen Welt auf verschiedene Art und Weisen bemerkbar. Noch kürzlich meinte jemand vor der Villa Wuller zu mir, dass die Villa ja schließlich das Trierische Berghain sei, gab aber lobenswerterweise auf meine Nachfrage, ob er denn schon mal in besagtem Club gewesen sei, wenigstens zu, dass dem nicht so ist.
Ich kann bis heute nicht so ganz für mich entscheiden, ob in Kontext dieses naiven Strebens nach dem Unbekannten, die positive Resonanz auf Hannes Stöhrs “Berlin Calling” einen Segen oder den Untergang bedeutet. Ich weiß zudem auch nicht so recht, ob man von einer weit fassenden Sensibilisierung für elektronische Musik sprechen kann, da nun sogar der A1-Besucher durch einen Film ansatzweise wahrgenommen hat, dass Tracks nicht so, sondern anders entstehen. (Vielleicht könnte ich versuchen, es mal daran zu messen, ob auch weiterhin Fräuleins bei unsren Gigs den hinter mir sitzenden Visual Artist anquatschen, weil sie glauben, es sei er, der gerade auflegt.) Außerdem kann ich mich auch noch nicht für oder gegen den Versuch, Menschen, welche die Clubszene nicht kennen, diese Kultur näher zu bringen, entscheiden. Gleiches gilt für die Absicht, die Wirkung von diversen Drogen erläutern zu wollen. Einen Rausch erklärt man nicht, man hat ihn oder eben auch nicht.
Der Film ist kein Meisterwerk, bedient sich aber einer recht ansprechenden visuellen Ästhetik und ist definitiv unterhaltsamer als der Saarbrücker Tatort. (Stöhr hätte es jedoch gerne dabei belassen können, Miloš Formans Drama gesehen zu haben, anstatt es dann als Vorlage für seinen Film zu benutzen, denn er tut sich und auch dem Publikum damit keinen Gefallen.) Kalkbrenner gelingt es recht gut, den Druffi zu mimen, woran diese schauspielerische Leistung wiederum festzumachen ist, ergibt sich jedoch von selbst. Er “spielt” den Charakter des Ickarus, der sich definitiv nicht durch komplexe Gedankengänge, geschweige denn durch weltbewegende Äußerungen auszeichnet.
Was diese Merkmale des Protagonisten anbelangt, sind keine direkten Abweichungen im Theaterstück von Gunnar Dreßler, das nun unter der Regie von Britta Benedetti am Theater Trier inszeniert wird, festzustellen. Eine hervorzuhebende Änderung, die man bereits aus dem Beschreibungstext im Spielplan der hiesigen Kulturstädte herauslesen kann, ist jedoch jene, dass Ickarus (gespielt von Matthias Stockinger) Drogen konsumiert, um “die Tage und Nächte durchzuhalten”. Ohne bezweifeln zu wollen, dass neben Koffein und Möhrchen, auch bestimmte Drogen den Wachzustand verlängern können und dementsprechend unter anderem deswegen bei vielerlei Menschen zum Einsatz kommen, fällt mir auf, dass allein durch diese Charakterisierung schon eine Wertung vorgenommen wird, die ich so im Film nicht wiederfinde. Stöhrs Ickarus ist ein Hedonist und Künstler, der sich zeitweilig gezielt, aber manchmal auch ungeplanterweise am Rande der Wahnsinns bewegt. Im Theaterstück wird jedoch ein anderer Beweggrund für den Drogenkonsum vermittelt und somit entsteht der Eindruck, dass nicht die realistische Skizzierung der Clubszene, sondern die Moral im Vordergrund steht.
Bevor wir uns falsch verstehen: Der Grad zwischen Drogenverherrlichung und der Verteuflung des Zeugs, ist in der Realität schlichtweg einfach alles andere schmal. Er ist hier aber, wie in den etlichen von Repression und vor allem Unkenntnis geprägten Diskussionen um die Legalisierung verschiedener Stoffe, mal wieder auf ein Schwarz-Weiß-Bild herunter gebrochen worden, nach dessen Graustufen man vergeblich sucht. Das Bild, das im Stück gezeichnet wird, ist nicht das eines Musikers, der auch die Schattenseiten seiner eigenen Hilfsmittel kennen lernt, sondern jenes eines Drogenkonsumenten aus dem Bilderbuch jener Leute, für die Rauschmittel konsumierende Menschen so etwas sind, wie eine seltene Tierart, die sie nur aus Dokumentationen oder aus dem Zoo kennen.
Dementsprechend fällt es mir auch schwer die Tatsache, dass beispielsweise manche Konsumtechniken schlichtweg falsch praktiziert werden, positiv oder negativ zu bewerten. Man muss sich hier einfach fragen von wem und für wen dieses Stück geschrieben ist. Im Endeffekt freue mich ja eigentlich sogar darüber, dass die Regisseurin scheinbar bisher weder was gezogen, noch Free Base geraucht hat. Zumindest wird im Stück kein Haschisch gespritzt, das ist schon mal gut. Aber dass es DEN Drogenkonsumenten und im Kontext des Films, sowie des Theaterstücks auch DIE Psychose nicht gibt, wird nicht transportiert. Es findet zwar ein gewisses Maß an Sensibilisierung für diese Themen statt, aber sie verfehlt, meiner Meinung nach, ihr Ziel, da sie sich unbeholfen konstruierter Fakten bedient.
Ich bin auch bezüglich des Castings sehr hin- und hergerissen. Der Ickarus der Benedettischen Inszenierung ist ein von sich selbst getriebener, impulsiver, halbwegs erwachsener Mann, der sich vor allem durch seine teils unkontrollierte, aber stets ausdrucksstarke Körpersprache auszeichnet. Eben diese körperliche Anstrengung nimmt der Hauptdarsteller Matthias Stockinger auf sich und sitzt zu fast keinem Moment des Stückes wirklich still. (Ich hab übrigens noch nie jemand so beeindruckend mit runtergelassener Hose an ner Kulisse hochklettern sehen.) Er fesselt das Publikum mit seiner schauspielerischen Leistung, aber man wird nicht automatisch in einen Bann des eigentlichen Hauptcharakters gezogen. Man fiebert nicht mit, sondern beobachtet. Der Mensch auf der Bühne ist nicht Ickarus, er ist kein Politoxikomane und auch kein Psychiatriepatient. Er ist guter Schauspieler und zudem einen ansehnlicher, junger Mann, den man sogar der Trierer Mutti, ohne einen Schock befürchten zu müssen, vorstellen würde. Und gerade hierbei zeigt sich für mich persönlich die Krux.
Eine weitere Schwierigkeit scheint, der Aussage der Regisseurin zufolge, bereits bei der Struktur des Originalstücks zu liegen. Dreßler habe Filmszenen ganz weggelassen, die für das Verständnis des Stücks jedoch relevant seien und einige Sprünge in den Dialogen hervorriefen. Wer den Film nicht gesehen hat, riskiert einige Male recht hilflos auf dem Schlauch zu stehen. Zudem richtet das Stück sich nicht unbedingt an Menschen, welche sich eine große Auseinandersetzung mit Musik erwarten. Massentaugliche Tracks wie “Sky and Sand” dienen als Hintergrundmusik. Nicht mehr und nicht weniger.
Wer jedoch seine Hausaufgaben macht und mit der nötigen Kenntnis der Story die Räumlichkeiten des Studios beim Rathaus betritt, der wird unter anderem bei jenen Szenen in denen Tim Olrik Stöneberg in einer seiner Rollen, als Drogendealer die Bühne betritt, auf seine Kosten kommen. Des Weiteren erobert „Crystal Pete“ (Daniel Kröhnert) die Herzen aller, wenn er beispielsweise nach einem T-Shirt sucht, das er gerade anhat und auch Alina Wolff beeindruckt mit dem starken Wechsel zwischen den drei weiblichen Rollen, in die sie blitzschnell schlüpfen muss. Bei Barbara Ullmann kann ich mich noch nicht so recht entscheiden, ob sie wirklich die Neurologin Dr. Petra Paul oder eher Corinna Harfouch spielt. Aber sie macht´s und es klappt. Michael Ophelders verdient sich einen kleinen Applaus mit seinem Sopran-Solo am Anfang des Stücks und mit seiner Rolle des Vaters von Ickarus wird im Stück ein Kontrastprogramm geschaffen, dass zumindest für einen Teil des Publikums mehr Identifikationsmöglichkeiten birgt als die restlichen Charaktere.
Zu guter Letzt spreche ich dem Team ganz unverhohlen meinen Respekt dafür aus, dass sie trotz der späten Absage seitens des Metropolis-Teams (das fälschlicherweise in einigen Texten als Forum bezeichnet wird*) das Problem des Bühnenbilds sehr gut gelöst haben. Was zuvor nämlich an drei verschiedenen Orten im Club vorgeführt werden sollte, wird nun anhand eines zweistöckigen Baugerüsts gelöst, in das die verschiedenen Ebenen des Stücks integriert sind.
Die ausverkaufte Premiere findet heute Abend statt, aber es sind noch Tickets für die darauffolgenden Vorstellungen erhältlich.
(*Oder muss man einem Club, den es so noch nicht gibt, überhaupt nen neuen Namen verleihen?)
(Alle Fotos laufen unter folgender Lizenz: CC BY- NC Michel Thiel)
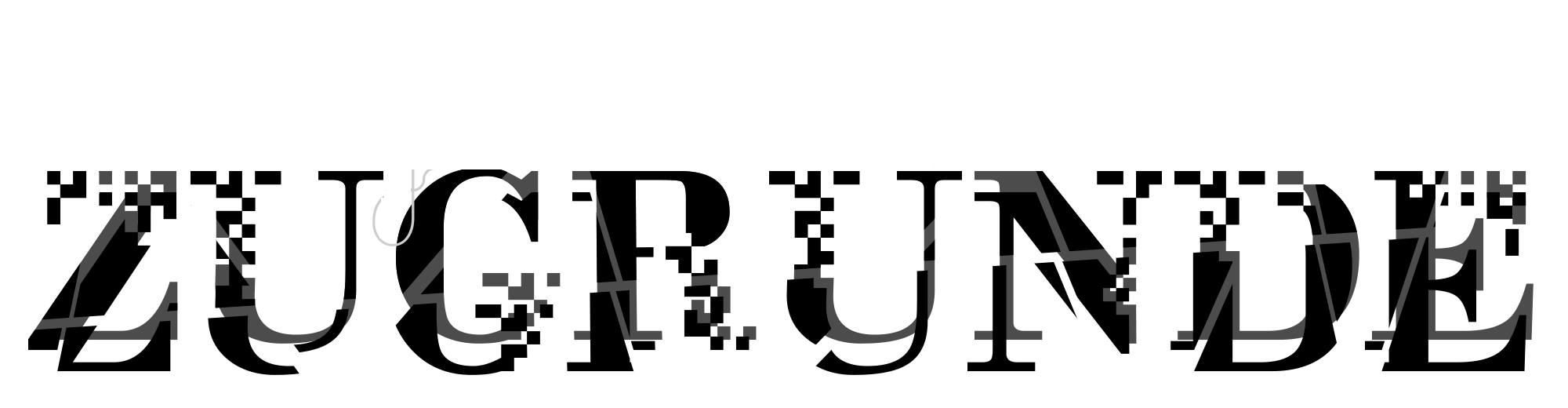









Leave a Reply