Ganz zu Beginn dieser Kritik sollte ich fair sein. Es gibt Trends. Trends werden, wenn sie sich durchsetzen Teil unseres Geschmacks und so erscheinen uns vorher merkwürdige Dinge plötzlich als ansprechend und interessant. Diesen Punkt muss ich einfach ansprechen, da „Captain Phillips“ ins gleiche Horn wie die jüngsten Filme der Regisseurin Kathryn Bigelow („Hurt Locker“ und „Zero Dark Thirty“) stößt. Eine wahre Geschichte mit militärischem Hintergrund. Und wer braucht heute noch ein gutes Drehbuch, wenn er sich mit wenigen Ausnahmen nur an die wahren Begebenheiten hält?
Nun, die einfache Antwort darauf ist: Menschen wie ich. Und ich könnte mich einfach selbst zitieren, indem ich auch „Captain Phillips“ eine filmisch und erzählerisch müde Umsetzung vorwerfe. Dass Mr. Phillips die Ereignisse der Kaperung verschriftlicht hat, ist absolut okay. Als therapeutische Maßnahme der Verarbeitung und um Freunden, Bekannten und Kollegen die Ereignisse beschreiben zu können, ist ein Buch ein erheblich leichterer Weg, als seine Geschichte immer wieder erzählen und sich die tragischen Ereignisse vor Augen führen zu müssen.
Der echte Captain Phillips (1. v. rechts) und andere Vorbilder
Dass man jedoch einen Film aus genau diesem Buch machen muss und anstatt dessen nicht ein echtes Drehbuch mit Höhen, Tiefen, Charakteren und dergleichen schreibt, ist für mich ein Makel, der aus filmischer Sicht nicht zu entschuldigen ist. Knapp ein Jahr nach meiner Erinnerung an Capotes „In Cold Blood“ muss ich wieder an dieses Buch erinnern, welches Erzählung und Wahrheit in einer Weise hat verschwimmen lassen, die tatsächlich Spannung aufgebaut hat. „Captain Phillips“ verlässt sich hingegen auf den Trend, den Frau Bigelow endgültig salon- und oscarfähig gemacht hat.
Die Kamera wackelt, wann sie nur kann, da dynamische und hektische Kameraeinstellungen immer intensiver wirken. Dazu ein pumpender Soundtrack, der zwischen „Mass Effect“ – wenn die Amerikaner am Zug sind – und arabisch folklorisch pumpenden Percussions – um die somalischen Piraten zu porträtieren – pendelt und für ordentlich Herzrasen sorgen soll. Und wenn die Piraten versuchen das Schiff zu entern, dann wird der Zuschauer über die Intensität von hektischem Bild, Ton und dem manischen Spiel der Piraten in den Sessel gedrückt.
Das war es dann allerdings auch schon. Ein menschliches Drama lässt sich nirgends vorfinden. Weder die Schiffsmannschaft, die Piraten, noch der Captain selbst sind großartige Charaktere, mit welchen man sich identifiziert oder dessen Probleme in irgendeiner Weise besprochen werden. Angeschnitten wird dafür unglaublich viel. Wir lernen Phillips’ Ehefrau kennen, sowie den Somali Muse, der sich den durchgeknalltesten Typen fürs Kentern aussucht. Das ist keine Charaktereinführung, sondern die Ermangelung dessen. Wenn die Mannschaft ihre Bedenken und Angst vor Piratenattacken äußert, dann ist das ein winziger Moment im Film und kein Thema, welches den Film begleitet.
Via flickry by andypeters-old-flickr-account
Wenn selbst Flugzeugträger einen jagen, ist man endgültig in der DANGERZONE
Fehlende Themen sind für mich dann auch schon das große Problem eines solchen Films, denn letztlich ist es nicht mehr als die Geschichte eines Mannes, der überlebt hat. Captain Phillips und seine Crew haben sich vorbildlich und nach Dienst verhalten und die Piraten haben das getan, was ihnen den Lebensunterhalt sichern sollte. Ob es Alternativen für diese Somalis gibt und wie der Zuschauer zu der größeren Thematik stehen soll, fragt der Film gar nicht. Es ist am Ende eine Geschichte die den Blick auf „das große Ganze“ verliert, weil nur noch das nackte Überleben zählt.
Die glaubwürdige Darstellung seitens der Schauspieler ist damit nur wenig wert für mich, da ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl habe, dass ich für irgendjemand fühlen soll. Ganz im Gegenteil steht man einem der Piraten, dem das Coca scheinbar zu sehr in den Kopf geschossen ist, so kritisch gegenüber, dass man sich dabei ertappt sich sein Ableben zu wünschen. Da dass allerdings auch der einzige Charakterzug des Piraten ist, reiht sich dieses scheinbar heraus stechende Merkmal in die kaum vorhandenen Charaktere dieses Films ein.
Der Trailer versucht uns einen packenden Drama-Thriller zu verkaufen… *hust* Mogelpackung *hust*
Besonders deutlich wird diese Schwäche des Films zum Abschluss, wenn „SPOILER“ Captain Phillips überlebt und vom Schiffsarzt untersucht wird. Der während des Kidnappings hoch funktionale Captain schaltet Körper und Geist nach all der Anstrengung auf ein Minimum herab und ist ein verwirrtes Häufchen elend, dem traumatisiert die Tränen kommen und der Sätze nur noch unfertig und stotternd herausbringt. Bravo, Tom Hanks. Das ist ernst gemeint. Denn nicht nur ist diese Szene großes Schauspiel, sondern auch der einzig „filmische“ Moment im Film, der einen die Ereignisse verdauen lässt. Ansonsten hat der Film zwar seine intensiven Momente, doch hinter dieser eindimensionalen Einbeziehung vergisst „Captain Phillips“ ganz oft ein Film zu sein.
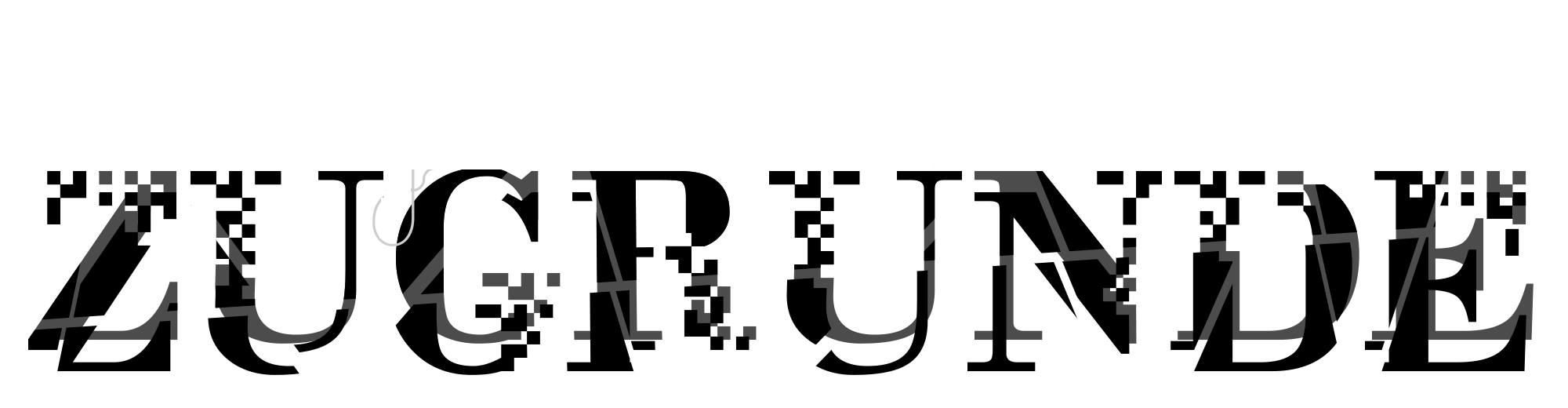





Leave a Reply