„Prisoners“ ist der Rächer des Kino-Jahres 2013. Ein in Sachen Mainstream wirklich karges Jahr, welches neben Comic-Fan-Freuden mit Ermüdungserscheinungen („Iron Man 3“ und „Man of Steel“) nicht viel bereit hielt, bekommt jetzt doch noch einen überragenden Film. Klar darf man Filme wie „The Conjuring“ und „Oz The Great And Powerful“ durchaus noch als positive Ausnahmen des Jahres hinstellen, aber alles in allem wurden wir unter Digitalmüll der Marke „Pacific Rim“ begraben.
Da einige von euch allerdings auch die von mir gescholtenen Filme wirklich mochten, möchte ich daran erinnern, dass Filmbewertungen auch immer ein Stück weit subjektiv sind. Deswegen ist es für mich umso wichtiger zu erwähnen, was für einen Heidenrespekt ich vor David Finchers Arbeit habe. Und dass ich David Fincher als Referenz für „Prisoners“ nutzen werde, ist ein dementsprechend großes Kompliment an Regisseur Denis Villeneuve, aber auch an Drehbuchautor Aaron Guzikowski, sowie den Rest des Teams und den Cast. Bei „Prisoners“ stimmt einfach eine ganze Menge.
Was würdest du tun?
Nach dem stimmungsvollen Trailer war ich in erster Linie gespannt, ob der Film die so beklemmende und intensive Atmosphäre aufrecht erhalten kann. Das Ergebnis hat meine Erwartungen übertroffen. Ähnlich wie „The Girl With The Dragon Tattoo“ (von mir aus egal welche Version, da beide Verfilmungen die Intensität gut einfangen) lässt der Film nach kurzer, aber nützlicher Exposition, in der die Charaktere und Dynamiken erklärt werden, dem Zuschauer keine Zeit zum Durchatmen. Über die komplette Spielzeit von gut zweieinhalb Stunden saß ich gefesselt vor der Leinwand, habe Fragen gestellt und Hypothesen konzipiert und nicht selten wurde dabei die Luft angehalten.
Der Film erfindet das Genre nicht neu, doch wie schonungslos hier mit physischer und psychischer Gewalt umgegangen wird, erlebt man leider zu selten in Hollywood-Filmen. Das letzte Mal hatte mich Finchers „Zodiac“ so in seinen Bann gezogen, dass mir selbst jeder Baum als ein im Film wichtiger Bestandteil der dargestellten Welt vorkam. Der Fall hat genug Haken und Ösen, dass sich das Publikum immer wieder Fragen stellen kann. Gleichzeitig liefert Guzikowskis Skript aber auch genug Zirkelschlüsse für den Zuschauer, dass dieser motiviert wird weiter zu Rätseln. Richtig geübte Kriminasen erraten bestimmt schon früher, wie der Fall am Ende aufgeklärt wird, doch wie das Drehbuch mit gewissen Passagen, Gegenständen und Handlungen spielt, macht aufmerksamen Zuschauern unabhängig davon eine Riesenfreude.
Neben der soliden und schön geschriebenen Geschichte setzt der Film nämlich auf Intensität und glaubwürdige Figuren, die allesamt nachvollziehbare Motivationen haben. Von Eltern, die gänzlich unterschiedlich und doch irgendwo gleich auf den Verlust ihrer Kleinkinder reagieren, über die daraufhin vernachlässigten großen Geschwister zeigt der Film viele kleine Facetten, die bei einer solchen Tragödie eintreffen können. Und dabei setzt der Film nicht auf Großaufnahmen und übertriebene Dialoge, sondern speist diesen Alltag, der droht nie wieder Alltag werden zu können, gerade zu nebensächlich und gleichzeitig glaubwürdig ab.
All diese guten Thematiken und Umsetzungen sind allerdings ohne einen starken Cast nur halb so gut und dass man am Ende Hugh Jackman mit der vielleicht besten Leistung seines Lebens hervorheben kann, hat nicht im Geringsten mit einem schwächelnden Rest-Cast zu tun. Auch wenn auf Seiten der Eltern Maria Bello als am Boden zerstörte Mutter den Großteil des Films unter Einwirkung von Beruhigungsmitteln/Anti-Depressiva „nur“ darstellt wie ein Mensch seinen Lebenswillen langsam aber sicher verliert, ist diese Rolle als mögliche Facette von Reaktionen glaubwürdig und für die Geschichte passend umgesetzt.
Für die einen ein Werkzeugkoffer, für die anderen die Folterbox des einfachen Menschens
Terrence Howard spielt einen Gutmensch sondergleichen, der die Hartnäckigkeit seines besten Freundes zwar immer hinterfragt, aber auch loyal zu ihm steht und die seine Ehefrau spielende Viola Davis bekommt ebenfalls ein paar sehr starke Zeilen und emotionale Szenen auf den Laib geschrieben, die das Szenario an den Zuschauer bringen. Doch über diesen sehr gut gespielten Figuren thront Hugh Jackmans Keller Dover. Der gläubige und etwas paranoide (mit Keller samt Vorrat an Nahrung, Brennstoffen und Gasmasken) Familienvater, der bereit ist alles zu tun, schreckt bei der Suche nach seiner Tochter auch nicht vor Lügen und Folter zurück. Der von Jackman gespielte Charakter stellt Moral und für einige Zuschauer wohl auch ein gutes Stück Menschlichkeit hinten an, um sein entführtes Kind zu retten.
Wie Jackman mit einem Hammer ein halbes Bad zertrümmert, ein Verhör gegen sich in eine emotionale Anschuldigung verwandelt oder er mit fast stoischer Ruhe Verdächtigen Gewalt androht, ist eine Augenweide. Man fühlt den Zorn und die Verzweiflung seines Keller Dover als Zuschauer in einer solchen Form, dass Jackman scheinbar mühelos einem starken Cast noch seinen Stempel aufdrückt. Natürlich hilft das Drehbuch, welches seine Rolle in den Mittelpunkt stellt. Doch trotz dieses Vorteils spielt Jackman die Rolle so, dass sich Eltern und solche die es werden wollen dabei ertappen werden, sich zu Fragen, ob sie so weit für ihr Kind gehen könnten oder wollten.
Da vergisst man fast, dass mit Jake Gyllenhaal ein ebenfalls sehr talentierter Schauspieler erneut eine starke Darstellung abliefert. Besonders in der zweiten Hälfte darf sein Detective Loki ein paar sehr gute Szenen abliefern, die Gyllenhaal mit Bravour meistert. Über den Rest des Casts möchte ich dagegen nicht genauer schreiben, da ich nicht unnötig zu viel verraten möchte. Die Schauspielarbeit ist allerdings auch bei weiteren, bekannten Schauspielern effektiv und zur jeweiligen Rolle passend, sodass man selbst immer wieder an eigenen Theorien zweifelt.
Die Liste der Stärken dieses Films ist lang und es fällt schwer ein besonderes Merkmal hervorzuheben. Hugh Jackmans Oscar würdige Leistung ist genauso erwähnenswert wie die Struktur des Films, der die Spannung über 150 Minuten aufrecht erhält. „Prisoners“ ist kein Film über den wir zwangsweise noch in 10 Jahren sprechen werden, da er nichts Neues macht, doch ähnlich wie David Finchers „Zodiac“ bündelt der Film seine Stärken so gekonnt, dass man einfach nichts kritisieren möchte.
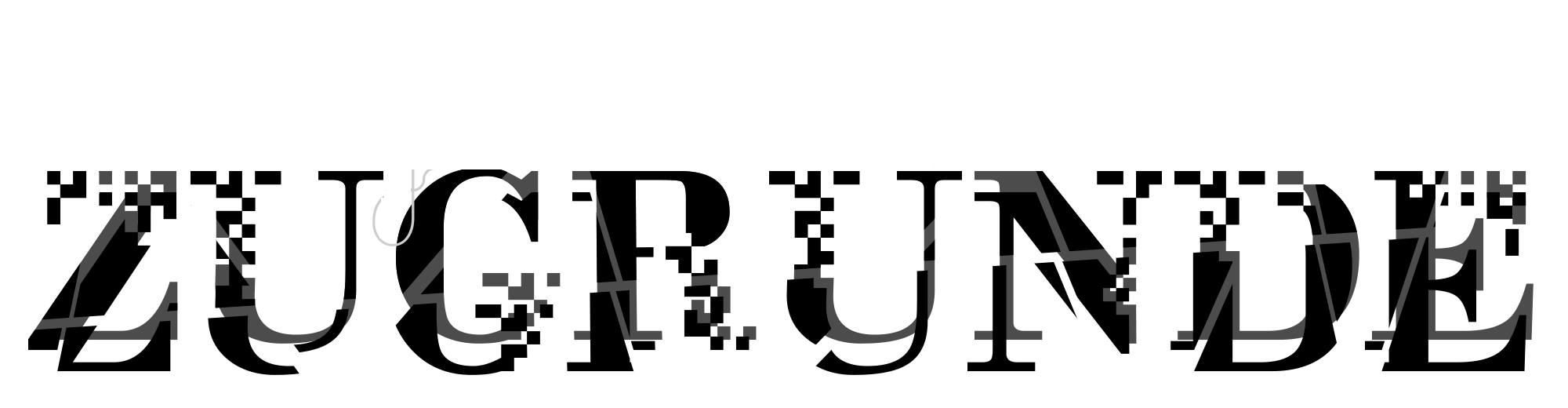





Leave a Reply